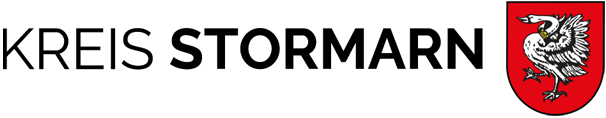Der Kreis Stormarn liest ein Buch
2012: "In Zeiten des abnehmenden Lichts"
"Ruge Dossier"
Zitate aus dem Buch "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von Eugen Ruge.
Zusammengestellt und um Zusatzinformationen ergänzt von Marion Graefe, Ahrensburg.
Klicken Sie einen Begriff aus dieser Tabelle an, um zu dem entsprechenden Zitat zu gelangen.
| A | B | C | D |
| E | F | G | H |
| I, J | K | L | M |
| N | O | P, Q | R |
| S | T | U, V, W | X, Y, Z |
Hinweis: Alle Links zu den Zusatzinformationen öffnen in einem neuen Fenster.
Alexander Seiten 7-32, 76-95, 96-114, 209-228, 229-241, 307-321, 407-Ende
 Zitat Seite 7:
Zitat Seite 7:
Zwei Tage hatte er wie tot auf seinem Büffelledersofa gelegen. Dann stand er auf, duschte ausgiebig, um auch den letzten Partikel Krankenhausluft von sich abzuwaschen, und fuhr nach Neuendorf. Er fuhr die A 115, wie immer. … Man kam direkt auf die Thälmannstraße (hieß immer noch so). … Aber man brauchte nur einmal links abzubiegen und ein paar hundert Meter dem krummen Steinweg zu folgen, dann noch einmal links - hier schien die Zeit stillzustehen: eine schmale Straße mit Linden. Kopfsteingepflasterte Bürgersteige, von Wurzeln verbeult. Morsche Zäune und Feuerwanzen. Tief in den Gärten, hinter hohem Gras, die toten Fenster von Villen, über deren Rückübertragung in fernen Anwaltskanzleien gestritten wurde. Eins der wenigen Häuser hier, die noch bewohnt waren: Am Fuchsbau sieben."
 Zitat Seite 8:
Zitat Seite 8:
"Tief in den Gärten, hinter hohem Gras, die toten Fenster von Villen, über deren Rückübertragung in fernen Anwaltskanzleien gestritten wurde."
 Zitat Seite 9:
Zitat Seite 9:
"Dann nahm er Kurt´s Gulasch aus der Mikrowelle, stellte es auf die Igelit-Decke."
 Zitat Seite 17:
Zitat Seite 17:
"Wo war der kleine Krummdolch, den der Schauspieler Gojkovic - Häuptling aller DEFA-Indianerfilme, immerhin! - Irina einmal geschenkt hatte?"
Zitat Seite 17:
 "Und wo war der Kuba-Teller, den die Genossen aus dem Karl-Marx-Werk Wilhelm zum neunzigsten Geburtstag überreicht hatten, und Wilhelm, so wurde erzählt, hatte die Brieftasche gezückt und einen Hunderter auf den Teller geknallt - weil er glaubte, er werde um eine Spende für die Volkssolidarität gebeten …"
"Und wo war der Kuba-Teller, den die Genossen aus dem Karl-Marx-Werk Wilhelm zum neunzigsten Geburtstag überreicht hatten, und Wilhelm, so wurde erzählt, hatte die Brieftasche gezückt und einen Hunderter auf den Teller geknallt - weil er glaubte, er werde um eine Spende für die Volkssolidarität gebeten …"
Zitat Seite 18:
 "… wie der riesige Kasten, den sie nur zum Schein abtransportierten, aus dem Kofferraum des kleinen Trabbi herausgeragt hatte, sodass das Auto vorn fast die Bodenhaftung verlor …"
"… wie der riesige Kasten, den sie nur zum Schein abtransportierten, aus dem Kofferraum des kleinen Trabbi herausgeragt hatte, sodass das Auto vorn fast die Bodenhaftung verlor …"
Zitat Seite 18/19:
"Die Bretter bogen sich unter der Last der Bücher; hier und da hatte Kurt ein zusätzliches, farblich nicht ganz passendes Brett eingezogen, aber die kosmische Ordnung war unverändert - eine Art letztes Back-up von Kurts Gehirn:  Dort standen die Nachschlagewerke, die auch Alexander mitunter benutzt hatte (Aber zurückstellen!), dort die Bücher zur russischen Revolution, da in langer Reihe die rostbraunen Lenin-Bände, und links neben Lenin, in der letzten Abteilung, unter dem Ordner mit der strengen Aufschrift PERSÖNLICH, stand noch immer - Alexander hätte es blindlings herausgreifen können - das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatte."
Dort standen die Nachschlagewerke, die auch Alexander mitunter benutzt hatte (Aber zurückstellen!), dort die Bücher zur russischen Revolution, da in langer Reihe die rostbraunen Lenin-Bände, und links neben Lenin, in der letzten Abteilung, unter dem Ordner mit der strengen Aufschrift PERSÖNLICH, stand noch immer - Alexander hätte es blindlings herausgreifen können - das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatte."
Zitat Seite 19f:
 "Wieder musste er an Markus denken: an seinen Sohn. Musste sich vorstellen, wie Markus hier umging, mit Kapuze und Kopfhörern in den Ohren - so hatte er ihn das letzte Mal, vor zwei Jahren, gesehen - , musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren hier angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ und auf Gebrauchswert oder Verkäuflichkeit prüfte: Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen. Für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark."
"Wieder musste er an Markus denken: an seinen Sohn. Musste sich vorstellen, wie Markus hier umging, mit Kapuze und Kopfhörern in den Ohren - so hatte er ihn das letzte Mal, vor zwei Jahren, gesehen - , musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren hier angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ und auf Gebrauchswert oder Verkäuflichkeit prüfte: Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen. Für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark."
Zitat Seite 20:
![]() "Er setzte sich an den Schreibtisch und öffnete die linke Tür. Im mittleren Schubfach ganz hinten, in der uralten ORWO-Fotopapierschachtel, lag, versteckt unter Klebstofftuben, seit vierzig Jahren der Schlüssel zum Wandsafe."
"Er setzte sich an den Schreibtisch und öffnete die linke Tür. Im mittleren Schubfach ganz hinten, in der uralten ORWO-Fotopapierschachtel, lag, versteckt unter Klebstofftuben, seit vierzig Jahren der Schlüssel zum Wandsafe."
Zitat Seite 20/21:
 "Hier hatte er … im Viereinhalb-Finger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert, tack-tack-tack-tack, Papa arbeitet! Sieben Seiten täglich, das war seine ‚Norm', aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! … ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem Zeug, ‚einer der produktivsten Historiker der DDR', hatte es geheißen, … hatte sein Werk noch immer eine Gesamtregalbreite, die fast mit der des Lenin'schen Werks konkurrieren konnte: ein Meter Wissenschaft. Für diesen Meter Wissenschaft hatte Kurt dreißig Jahre geschuftet, dreißig Jahre lang die Familie terrorisiert. … Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen, aber auch Rüffel und einmal sogar eine Rüge von der Partei erhalten, hatte mit den vom ewigen Papiermangel gebeutelten Verlagen um Auflagenhöhen gefeilscht, hatte einen Kleinkrieg um Formulierungen und Titel geführt, hatte aufgeben müssen oder hatte mit List und Zähigkeit Teilerfolge erzielt - und nun war alles, alles MAKULATUR."
"Hier hatte er … im Viereinhalb-Finger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert, tack-tack-tack-tack, Papa arbeitet! Sieben Seiten täglich, das war seine ‚Norm', aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! … ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem Zeug, ‚einer der produktivsten Historiker der DDR', hatte es geheißen, … hatte sein Werk noch immer eine Gesamtregalbreite, die fast mit der des Lenin'schen Werks konkurrieren konnte: ein Meter Wissenschaft. Für diesen Meter Wissenschaft hatte Kurt dreißig Jahre geschuftet, dreißig Jahre lang die Familie terrorisiert. … Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen, aber auch Rüffel und einmal sogar eine Rüge von der Partei erhalten, hatte mit den vom ewigen Papiermangel gebeutelten Verlagen um Auflagenhöhen gefeilscht, hatte einen Kleinkrieg um Formulierungen und Titel geführt, hatte aufgeben müssen oder hatte mit List und Zähigkeit Teilerfolge erzielt - und nun war alles, alles MAKULATUR."
Zitat Seite 24:
 "Und tatsächlich, sobald er sich Irina hier vorzustellen versuchte, sah er sie auf dem Fußboden sitzen, bei ihren einsamen Orgien, wenn sie ihre krächzenden Wyssozki-Kassetten hörte und sich allmählich betrank."
"Und tatsächlich, sobald er sich Irina hier vorzustellen versuchte, sah er sie auf dem Fußboden sitzen, bei ihren einsamen Orgien, wenn sie ihre krächzenden Wyssozki-Kassetten hörte und sich allmählich betrank."
Zitat Seite 28:
 "Nur die Melodie fiel ihm ein - von Oma Charlottes uralterSchellackplatte, die ihm beim Umzug auf den Gehweg gefallen und in tausend Stücke zersprungen war:
"Nur die Melodie fiel ihm ein - von Oma Charlottes uralterSchellackplatte, die ihm beim Umzug auf den Gehweg gefallen und in tausend Stücke zersprungen war:
Mexico lindo y querido Si muerto lejos de ti …"
Zitat Seite 31:
 "…und da, schließlich, am Ende der Straße, war das Haus seiner Großeltern. Es war bereits ‚rückübertragen'. Jetzt wurde es von den Enkeln des ehemaligen Besitzers bewohnt, eines mittleren Nazis, der mit der Fabrikation von Scherenfernrohren reich geworden war."
"…und da, schließlich, am Ende der Straße, war das Haus seiner Großeltern. Es war bereits ‚rückübertragen'. Jetzt wurde es von den Enkeln des ehemaligen Besitzers bewohnt, eines mittleren Nazis, der mit der Fabrikation von Scherenfernrohren reich geworden war."
 Zitat Seite 32:
Zitat Seite 32:
"Dort die ‚Volksbuchhandlung', jetzt Reisebüro."
Zitat Seite 32:
 "Und dort der Konsum, Betonung auf der ersten Silbe (und tatsächlich hatte es mit Konsum wenig zu tun), wo es vor sehr langer Zeit - Alexander konnte sich gerade noch daran erinnern - Milch auf Marken gegeben hatte."
"Und dort der Konsum, Betonung auf der ersten Silbe (und tatsächlich hatte es mit Konsum wenig zu tun), wo es vor sehr langer Zeit - Alexander konnte sich gerade noch daran erinnern - Milch auf Marken gegeben hatte."
Zitat Seite 76:
 "Beifall rauschte. Jetzt war er berühmt. Er stand in einem offenen schwarzen Tschaika, der sagenhaften sowjetischen Staatskarosse mit massenhaft Chrom und raketenartigen Heckflügeln: Langsam rollte das Gefährt durch die Straße. Links und rechts standen die Menschen Spalier, so wie am Ersten Mai, und winkten ihm zu, mit kleinen, schwarz-rot-goldenen Fähnchen …"
"Beifall rauschte. Jetzt war er berühmt. Er stand in einem offenen schwarzen Tschaika, der sagenhaften sowjetischen Staatskarosse mit massenhaft Chrom und raketenartigen Heckflügeln: Langsam rollte das Gefährt durch die Straße. Links und rechts standen die Menschen Spalier, so wie am Ersten Mai, und winkten ihm zu, mit kleinen, schwarz-rot-goldenen Fähnchen …"
Zitat Seite 77:
 "Im Konsum gab es Milch gegen Marke. Mit einer großen Kelle füllte die Verkäuferin die Kanne. Früher hatte das immer Frau Blumert getan. Aber Frau Blumert hatte man verhaftet. Er wusste auch, warum: weil sie Milch ohne Marke verkauft hatte. Hatte Achim Schließner gesagt. Milch ohne Marke war streng verboten."
"Im Konsum gab es Milch gegen Marke. Mit einer großen Kelle füllte die Verkäuferin die Kanne. Früher hatte das immer Frau Blumert getan. Aber Frau Blumert hatte man verhaftet. Er wusste auch, warum: weil sie Milch ohne Marke verkauft hatte. Hatte Achim Schließner gesagt. Milch ohne Marke war streng verboten."
Zitat Seite 80:
 "Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er immer. Morphy hat schon mit sechs Jahren gegen seinen Vater gewonnen, sagte sein Vater. Das war aber nicht so schlimm. Er war ja erst vier. Erst mal musste er fünf werden. Und dann hatte er immer noch Zeit. Sehr viel Zeit, um seinen Vater im Schach zu besiegen."
"Später Schachspielen. Papa gab ihm zwei Türme vor, trotzdem gewann er immer. Morphy hat schon mit sechs Jahren gegen seinen Vater gewonnen, sagte sein Vater. Das war aber nicht so schlimm. Er war ja erst vier. Erst mal musste er fünf werden. Und dann hatte er immer noch Zeit. Sehr viel Zeit, um seinen Vater im Schach zu besiegen."
Zitat Seite 90:
 "Er erinnerte sich an nichts. Aber er kannte alles. Sogar den Geruch der Moskauer Taxis: halb nach angebranntem Gummi, halb nach Benzin. Ganz Moskau schien ein bisschen nach Taxi zu riechen. Der rote Platz:: ein Schlange vorm Mausoleum. Nein, Saschenka, so viel Zeit haben wir nicht. Dafür Eskimo-Eis. Und Prostokwascha mit Zucker."
"Er erinnerte sich an nichts. Aber er kannte alles. Sogar den Geruch der Moskauer Taxis: halb nach angebranntem Gummi, halb nach Benzin. Ganz Moskau schien ein bisschen nach Taxi zu riechen. Der rote Platz:: ein Schlange vorm Mausoleum. Nein, Saschenka, so viel Zeit haben wir nicht. Dafür Eskimo-Eis. Und Prostokwascha mit Zucker."
 Zitat Seite 90:
Zitat Seite 90:
"Die Metro: gigantisch. Vor der Rolltreppe hatte er ein bisschen Angst. Noch mehr von den Türen."
 Zitat Seite 91:
Zitat Seite 91:
"Für Tee wurde der Samowar angeheizt. Es gab schwarzen Tee: früh, mittags abends. Der Samowar summte."
Zitat Seite 91:
 "Einmal die Woche kam Brot. Dann stand eine lange Schlange vor dem Laden. Jeder bekam drei Laib Brot. Auch Alexander. Zu dritt bekamen sie neun Jedes kostete elf Kopeken. Drei Brote äßen sie selber, sechs kriegte die Kuh. In Wasser eingeweicht. Die Kuh schmatzte. Es schmeckte ihr."
"Einmal die Woche kam Brot. Dann stand eine lange Schlange vor dem Laden. Jeder bekam drei Laib Brot. Auch Alexander. Zu dritt bekamen sie neun Jedes kostete elf Kopeken. Drei Brote äßen sie selber, sechs kriegte die Kuh. In Wasser eingeweicht. Die Kuh schmatzte. Es schmeckte ihr."
Zitat Seite 93f:
 "Die Sowjetunion ist das größte Land der Welt. Wilhelm nickte zufrieden. Sah ihn erwartungsvoll an. Auch Omi sah ihn erwartungsvoll an. Und Alexander fügte hinzu: - Aber Achim Schliepner ist dumm. Der sagt, dass Amerika das größte Land der Welt ist. - Aha, sagte Wilhelm, interessant. Und zu Omi sagte er: - Und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliepners. Aber die kriegen wir auch noch dran."
"Die Sowjetunion ist das größte Land der Welt. Wilhelm nickte zufrieden. Sah ihn erwartungsvoll an. Auch Omi sah ihn erwartungsvoll an. Und Alexander fügte hinzu: - Aber Achim Schliepner ist dumm. Der sagt, dass Amerika das größte Land der Welt ist. - Aha, sagte Wilhelm, interessant. Und zu Omi sagte er: - Und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliepners. Aber die kriegen wir auch noch dran."
Zitat Seite 213:
 "Sie gingen durch eine unbekannte Stadt, die Halberstadt hieß und in der es von Soldaten mit ihren Familien wimmelte. Die Restaurants waren überfüllt. Christina hatte die Idee, ein Stück auswärts ein Restaurant zu suchen, aber Alexanders Ausgang war - selbstverständlich - auf Halberstadt beschränkt. Also aßen sie in einem überfüllten Restaurant, wo es nur noch Letschosteak gab, Letschosteak."
"Sie gingen durch eine unbekannte Stadt, die Halberstadt hieß und in der es von Soldaten mit ihren Familien wimmelte. Die Restaurants waren überfüllt. Christina hatte die Idee, ein Stück auswärts ein Restaurant zu suchen, aber Alexanders Ausgang war - selbstverständlich - auf Halberstadt beschränkt. Also aßen sie in einem überfüllten Restaurant, wo es nur noch Letschosteak gab, Letschosteak."
Zitat Seite 217f:
 "Zum ersten Mal händigte man ihnen nicht nur die Waffe aus, sondern auch zwei volle Magazine mit je dreißig Schuss Munition. Beim anschließenden Appell erklärte der Kompaniechef, ein kurzbeiniger Mann mit scharfer Stimme, dass sie im Grenzabschnitt Sowieso zur Hinterlandsicherung eingesetzt würden, da eine sogenannte Lage entstanden sei: Ein Soldat der Sowjetarmee sei mit einem Autobus Typ Ikarus, einer Kalaschnikow und sechzig Schuss Munition unterwegs, vermutlich in Richtung Staatsgrenze zwischen Stapelburg und dem Brocken."
"Zum ersten Mal händigte man ihnen nicht nur die Waffe aus, sondern auch zwei volle Magazine mit je dreißig Schuss Munition. Beim anschließenden Appell erklärte der Kompaniechef, ein kurzbeiniger Mann mit scharfer Stimme, dass sie im Grenzabschnitt Sowieso zur Hinterlandsicherung eingesetzt würden, da eine sogenannte Lage entstanden sei: Ein Soldat der Sowjetarmee sei mit einem Autobus Typ Ikarus, einer Kalaschnikow und sechzig Schuss Munition unterwegs, vermutlich in Richtung Staatsgrenze zwischen Stapelburg und dem Brocken."
Charlotte Seiten 33-54, 115-138, 389-406
Zitat Seite 36:
 "Fünf Mal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts, sie saßen immer noch hier. Sie saßen hier - während drüben, im neuen Staat, die Posten verteilt wurden."
"Fünf Mal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts, sie saßen immer noch hier. Sie saßen hier - während drüben, im neuen Staat, die Posten verteilt wurden."
Zitat Seite 37:
 "… und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatte. Wegen ‚Verstoßes gegen die Parteidisziplin'. Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr ‚Verstoß gegen die Parteidisziplin hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als ‚uninteressant abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal."
"… und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatte. Wegen ‚Verstoßes gegen die Parteidisziplin'. Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr ‚Verstoß gegen die Parteidisziplin hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als ‚uninteressant abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal."
Zitat Seite 38:
 "Charlotte kümmerte sich um den Haushalt: Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blumen. Seit langem züchtete sie auf der Dachterrasse eine Königin der Nacht. Sie hatte sie vor Jahren gekauft, in der zwiespältigen Hoffnung, dass sie nie sehen würde, wie sie blühte."
"Charlotte kümmerte sich um den Haushalt: Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blumen. Seit langem züchtete sie auf der Dachterrasse eine Königin der Nacht. Sie hatte sie vor Jahren gekauft, in der zwiespältigen Hoffnung, dass sie nie sehen würde, wie sie blühte."
Zitat Seite 41:
 "Drei berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie sie eher balancierten als trugen, was den drei Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor zwölf Jahren das Leben gerettet hatte …"
"Drei berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie sie eher balancierten als trugen, was den drei Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor zwölf Jahren das Leben gerettet hatte …"
Zitat Seite 42:
 "Wilhelm hatte, im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nichts. Zwar war er tatsächlich einmal - auf dem Papier - Co-Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies - aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung - nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zweitens war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material diente."
"Wilhelm hatte, im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nichts. Zwar war er tatsächlich einmal - auf dem Papier - Co-Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies - aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung - nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zweitens war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material diente."
 Zitat Seite 43:
Zitat Seite 43:
"Charlotte begann sich um die Auflösung des Haushalts zu kümmern, kündigte Verträge und verkaufte die Königin der Nacht mit Verlust zurück an den Blumenladen."
Zitat Seite 44:
 "Sie gingen, wie schon oft, in ein kleines Restaurant in Tacubaya, dessen einziger Nachteil darin bestand, dass das sowjetische Konsulat in der Nähe war. Adrian bestellte zwei Gläser Weißwein und chiles en nogada, und noch bevor das Essen kam, fragte er Charlotte, ob sie wisse, dass man Slánský zum Tode verurteilt habe."
"Sie gingen, wie schon oft, in ein kleines Restaurant in Tacubaya, dessen einziger Nachteil darin bestand, dass das sowjetische Konsulat in der Nähe war. Adrian bestellte zwei Gläser Weißwein und chiles en nogada, und noch bevor das Essen kam, fragte er Charlotte, ob sie wisse, dass man Slánský zum Tode verurteilt habe."
Zitat Seite 47:
 "Indessen schien es Wilhelm von Tag zu Tag besserzugehen. Eben noch, auf der anderen Seite des Ozeans, hatte er unter chronischer Schlaflosigkeit gelitten und sich über mangelnden Appetit beklagt. Aber je weniger Charlotte aß, desto größer schien Wilhelms Hunger zu werden. Er schlief gut, machte Täglich, auch bei dem größten Dreckswetter, ausgedehnte Spaziergänge an Deck und beschwerte sich, wenn er mit seinem durchweichten, aber offenbar unverwüstlichen Tardan-Hut zurückkam, dass Charlotte die ganze Zeit in der Kabine hockte."
"Indessen schien es Wilhelm von Tag zu Tag besserzugehen. Eben noch, auf der anderen Seite des Ozeans, hatte er unter chronischer Schlaflosigkeit gelitten und sich über mangelnden Appetit beklagt. Aber je weniger Charlotte aß, desto größer schien Wilhelms Hunger zu werden. Er schlief gut, machte Täglich, auch bei dem größten Dreckswetter, ausgedehnte Spaziergänge an Deck und beschwerte sich, wenn er mit seinem durchweichten, aber offenbar unverwüstlichen Tardan-Hut zurückkam, dass Charlotte die ganze Zeit in der Kabine hockte."
 Zitat Seite 50:
Zitat Seite 50:
"Charlotte schämte sich. Für ihren Hutschleier. Für ihre Angst. Für die fünfzig Dosen Nescafé in ihrem Koffer …"
Zitat Seite 51:
"Der Mann klappte die Zeitung ganz auf, sodass für Charlotte die Titelseite sichtbar wurde, und wie von selbst fiel ihr Blick auf eine Bildunterschrift mit den Worten:
Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Genosse …
Und jetzt hätte eigentlich kommen müssen: Karl-Heinz Dretzky. Kam aber nicht.
Der Zug ruckelte über ein Weichenfeld. Charlotte taumelte im Gang hin und her, spürte kaum, wie sie anstieß. Mit Mühe erreichte sie die Toilette, riss - mit bloßen Händen - den Klodeckel auf und erbrach das wenige, was sie zum Frühstück gegessen hatte. Sie klappte den Deckel hinunter, setzte sich drauf.  Das Tam-Tam der Zugräder ging ihr jetzt direkt in die Zähne, direkt in den Kopf. Sie spürte noch immer den kalten, prüfenden Blick, der sie über den Rand der Zeitung hinweg getroffen hatte. Schwarzer Ledermantel - ausgerechnet. Es war alles klar, alles passte zusammen.
Das Tam-Tam der Zugräder ging ihr jetzt direkt in die Zähne, direkt in den Kopf. Sie spürte noch immer den kalten, prüfenden Blick, der sie über den Rand der Zeitung hinweg getroffen hatte. Schwarzer Ledermantel - ausgerechnet. Es war alles klar, alles passte zusammen.
Eingeschleust hieß das entsprechende Wort. Eingeschleust durch den zionistischen Agenten Dretzky. Es quietschte und krächzte, als könnte der Zug auseinanderbrechen. Sie hielt ihren Kopf mit beiden Händen fest … Oder drehte sie durch? Nein, sie war ganz bei Verstand. War so klar im Kopf wie schon lange nicht mehr … Hätte wenigstens da gestanden: der neue Staatssekretär … Sie kicherte fast vor Vergnügen darüber, wie fein sie die Nuancen zu unterscheiden gelernt hatte. Der neue Staatssekretär: Das hieße, es gab einen alten … Aber es gab keinen alten. Er existierte nicht. Sie waren die Protegés eines Nichtexistenten. Sie waren selber so gut wie nichtexistent. Auf dem Ostbahnhof würden Männer in schwarzen Ledermänteln stehen, und Charlotte würde ihnen folgen, ohne Widerstand, ohne Lärm. Würde Geständnisse unterschreiben. Würde verschwinden. Wohin? Sie wusste es nicht. Wo waren die, deren Namen nicht mehr genannt wurden? Die nicht nur nicht existierten, sondern nie existiert hatten?"
Zitat Seite 52:
 "Charlotte antwortete nicht. Setzte sich, schaute aus dem Fenster. Sah die Felder, die Hügel, sah sie und sah sie nicht. Staunte, dass sie jetzt vor allem Ärger empfand. Staunte darüber, was sie jetzt dachte. Sie dachte, dass sie an etwas Wichtiges denken müsste. Aber sie dachte an ihre Schweizer Schreibmaschine ohne ‚ß'."
"Charlotte antwortete nicht. Setzte sich, schaute aus dem Fenster. Sah die Felder, die Hügel, sah sie und sah sie nicht. Staunte, dass sie jetzt vor allem Ärger empfand. Staunte darüber, was sie jetzt dachte. Sie dachte, dass sie an etwas Wichtiges denken müsste. Aber sie dachte an ihre Schweizer Schreibmaschine ohne ‚ß'."
 Zitat Seite 116:
Zitat Seite 116:
"Im Flur klickerte eine defekte Neonröhre. An den Türen waren noch immer die Flecken zu sehen, die die Russen nach dem Krieg mit ihren Machorkas eingebrannt hatten."
 Zitat Seite 116:
Zitat Seite 116:
"Allerdings fiel ihr im selben Moment ein, dass der Hausmeister gerade, vor wenigen Tagen, in den Westen abgehauen war."
 Zitat Seite 117:
Zitat Seite 117:
"Die Wandzeitung kündete vom neuesten Triumph der sowjetischen Technik und Wissenschaft: Vorgestern war ein Sowjetbürger namens Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen."
 Zitat Seite 120:
Zitat Seite 120:
"Schon 1940 in Frankreich, im Internierungslager Vernet, hatte Wilhelm durch den Skorbut alle Zähne verloren, und wenn noch nicht alle, dann den Rest auf dem Weg nach Casablanca."
 Zitat Seite 122:
Zitat Seite 122:
"Wohnbezirksparteisekretär: Das war der Mann, der den Parteibeitrag der zehn oder fünfzehn Veteranen zwischen Thälmannstraße und OdF-Platz kassierte - nichts weiter. "
Zitat Seite 122:
 "Aber was machte Wilhelm? Hielt irgendwelche geheimen Versammlungen ab, da unten in seiner Zentrale, plante irgendwelche ‚Operationen'. Zu den letzten Kommunalwahlen hatte er eine motorisierte Einsatzstaffel organisiert, um denjenigen, die am frühen Nachmittag immer noch nicht gewählt hatten, Agitatoren auf den Hals zu schicken: Den ganzen Rasen hatten diese Trottel zerfahren!"
"Aber was machte Wilhelm? Hielt irgendwelche geheimen Versammlungen ab, da unten in seiner Zentrale, plante irgendwelche ‚Operationen'. Zu den letzten Kommunalwahlen hatte er eine motorisierte Einsatzstaffel organisiert, um denjenigen, die am frühen Nachmittag immer noch nicht gewählt hatten, Agitatoren auf den Hals zu schicken: Den ganzen Rasen hatten diese Trottel zerfahren!"
Zitat Seite 138:
 "Wilhelms Tombola wurde ein großer Erfolg. Der Kreissekretär hielt eine Rede. Und der Vertreter der Nationalen Front verlieh Wilhelm die goldene Ehrennadel."
"Wilhelms Tombola wurde ein großer Erfolg. Der Kreissekretär hielt eine Rede. Und der Vertreter der Nationalen Front verlieh Wilhelm die goldene Ehrennadel."
Zitat Seite 394:
 "Schon beim Gedanken daran begann ihr Atem zu rasseln. Sie überlegte, ob sie doch noch einmal zehn Tropfen Aminophyllinnehmen sollte. Allerdings hatte sie heute bereits zwei Mal Aminophyllin genommen, und seit Doktor Süß ihr gesagt hatte, dass eine Überdosis zur Lähmung der Atemwegsmuskulatur führen konnte, hatte sie ständig Angst, ihr Atem könnte stehenbleiben, plötzlich, in der Nacht, könnte sie aufhören zu atmen."
"Schon beim Gedanken daran begann ihr Atem zu rasseln. Sie überlegte, ob sie doch noch einmal zehn Tropfen Aminophyllinnehmen sollte. Allerdings hatte sie heute bereits zwei Mal Aminophyllin genommen, und seit Doktor Süß ihr gesagt hatte, dass eine Überdosis zur Lähmung der Atemwegsmuskulatur führen konnte, hatte sie ständig Angst, ihr Atem könnte stehenbleiben, plötzlich, in der Nacht, könnte sie aufhören zu atmen."
Irina Seiten 55-75, 242-268, 351-370
Zitat Seite 55:
 "Es war die Stille eines abgeschnittenen Ortes, der seit über einem Vierteljahrhundert im Windschatten der Grenzanlagen vor sich hin dämmerte, ohne Durchgangsverkehr, ohne Baulärm, ohne moderne Gartengeräte."
"Es war die Stille eines abgeschnittenen Ortes, der seit über einem Vierteljahrhundert im Windschatten der Grenzanlagen vor sich hin dämmerte, ohne Durchgangsverkehr, ohne Baulärm, ohne moderne Gartengeräte."
 Zitat Seite 57:
Zitat Seite 57:
"Jedes Jahr wurde derselbe miserable Kognak in denselben bunten Aluminiumbechern serviert."
 Zitat Seite 59:
Zitat Seite 59:
"Bis zehn Uhr musste sie die Blumen abgeholt haben. Dann noch ins Russenmagazin, die Belomorkanal holen."
Zitat Seite 61:
 "Wie jeder andere hatte nämlich auch Sascha seine ‚spezielle Aufgabe' - Charlotte liebte es, alle Leute mit ‚speziellen Aufgaben' zu betrauen, es gab sogar einen Blumenpapier-Verantwortlichen, und einen Verantwortlichen für das Abwischen der infolge der schlecht funktionierenden Abfüllautomaten ständig verklebten Vita-Cola-Flaschen."
"Wie jeder andere hatte nämlich auch Sascha seine ‚spezielle Aufgabe' - Charlotte liebte es, alle Leute mit ‚speziellen Aufgaben' zu betrauen, es gab sogar einen Blumenpapier-Verantwortlichen, und einen Verantwortlichen für das Abwischen der infolge der schlecht funktionierenden Abfüllautomaten ständig verklebten Vita-Cola-Flaschen."
Zitat Seite 62:
 "Wenn nämlich Sascha, für elf Uhr bestellt, mit dem Ausziehen des Ausziehtisches fertig war, lohnte sich für ihn die Rückfahrt nach Berlin nicht, sodass er die Zeit bis zum Beginn der Geburtstagsfeier gewöhnlich im Fuchsbau blieb, und dann würden sie, wie jedes Jahr, zusammen Pelmeni essen, mit saurer Sahne und Senf, wie Sascha es mochte."
"Wenn nämlich Sascha, für elf Uhr bestellt, mit dem Ausziehen des Ausziehtisches fertig war, lohnte sich für ihn die Rückfahrt nach Berlin nicht, sodass er die Zeit bis zum Beginn der Geburtstagsfeier gewöhnlich im Fuchsbau blieb, und dann würden sie, wie jedes Jahr, zusammen Pelmeni essen, mit saurer Sahne und Senf, wie Sascha es mochte."
 Zitat Seite 65:
Zitat Seite 65:
"Irina setzte sich und fingerte eine ‚Club' aus der Schachtel."
Zitat Seite 67:
 "Es handelte sich um zehn Schachteln Belomorkanal: klassische russische Papirossy, die Irina im Buffet des sogenannten Hauses der Offiziere für ihn besorgte - abscheuliches Zeug eigentlich, das Wilhelm aus reiner Angeberei rauchte, um seinen Genossen vorzuführen, wie er das Pappmundstück zu knicken verstand, während er seine drei Brocken Russisch zum Besten gab und vage Andeutungen über seine ‚Moskauer Zeit' machte."
"Es handelte sich um zehn Schachteln Belomorkanal: klassische russische Papirossy, die Irina im Buffet des sogenannten Hauses der Offiziere für ihn besorgte - abscheuliches Zeug eigentlich, das Wilhelm aus reiner Angeberei rauchte, um seinen Genossen vorzuführen, wie er das Pappmundstück zu knicken verstand, während er seine drei Brocken Russisch zum Besten gab und vage Andeutungen über seine ‚Moskauer Zeit' machte."
Zitat Seite 68:
 "Als Irina aus dem Bad zurückkam, blätterte Kurt in der Zeitung. Sein Teller war noch immer unbenutzt, ohne Krümel. - Warum isst du nichts, sagte Irina. Du kriegst bloß wieder Magenschmerzen. - Wirklich kein einziges Wort, sagte Kurt. Keine Silbe über Ungarn, kein Wort über Flüchtlinge, nichts über die Botschaft in Prag … Er faltete die Zeitung zusammen, knallte sie auf den Tisch. Auf der Titelseite war groß zu lesen: IN DEN KÄMPFEN UNSERER ZEIT STEHEN DDR UND VR CHINA SEITE AN SEITE Irina hatte die Überschrift schon gestern gesehen - es war die Wochenendausgabe des ND, die Kurt noch nicht gelesen hatte, weil gestern die Literaturnaja Gazeta aus Moskau gekommen war. Irina fragte sich, warum er diesen Mist überhaupt noch las: Neues Deutschland!"
"Als Irina aus dem Bad zurückkam, blätterte Kurt in der Zeitung. Sein Teller war noch immer unbenutzt, ohne Krümel. - Warum isst du nichts, sagte Irina. Du kriegst bloß wieder Magenschmerzen. - Wirklich kein einziges Wort, sagte Kurt. Keine Silbe über Ungarn, kein Wort über Flüchtlinge, nichts über die Botschaft in Prag … Er faltete die Zeitung zusammen, knallte sie auf den Tisch. Auf der Titelseite war groß zu lesen: IN DEN KÄMPFEN UNSERER ZEIT STEHEN DDR UND VR CHINA SEITE AN SEITE Irina hatte die Überschrift schon gestern gesehen - es war die Wochenendausgabe des ND, die Kurt noch nicht gelesen hatte, weil gestern die Literaturnaja Gazeta aus Moskau gekommen war. Irina fragte sich, warum er diesen Mist überhaupt noch las: Neues Deutschland!"
Zitat Seite 69:
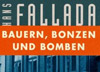 "Irina zuckte mit den Schultern. Auch das Foto hatte sie schon gesehen: irgendwelche Bonzen, die in drei langen Reihen hintereinanderstanden, so grobkörnig, dass man die zahlreichen Chinesen nur mit Mühe von den Deutschen unterscheiden konnte."
"Irina zuckte mit den Schultern. Auch das Foto hatte sie schon gesehen: irgendwelche Bonzen, die in drei langen Reihen hintereinanderstanden, so grobkörnig, dass man die zahlreichen Chinesen nur mit Mühe von den Deutschen unterscheiden konnte."
Zitat Seite 70:
 "Sie wusste, wie man sich fühlte so nah an einem Panzer. Zwei Jahre lang war sie, wenn auch nur als Sanitäterin, im Krieg gewesen. Sie erkannte einen T-34 am Anfahrgeräusch."
"Sie wusste, wie man sich fühlte so nah an einem Panzer. Zwei Jahre lang war sie, wenn auch nur als Sanitäterin, im Krieg gewesen. Sie erkannte einen T-34 am Anfahrgeräusch."
Zitat Seite 71:
 "Erst als sie schon wieder im Wohnzimmer war, drang ihr der Geruch im Zimmer von Nadjeshda Iwanowna ins Bewusstsein - neben verschimmelnden Lebensmitteln und penetranten, wenngleich nutzlosen Fußsalben war es vor allem der alles übertönende, süßliche Muff des aus Russland mitgebrachten Mottenpulvers, das Nadjeshda Iwanowna in lebensfeindlicher Konzentration verwendete."
"Erst als sie schon wieder im Wohnzimmer war, drang ihr der Geruch im Zimmer von Nadjeshda Iwanowna ins Bewusstsein - neben verschimmelnden Lebensmitteln und penetranten, wenngleich nutzlosen Fußsalben war es vor allem der alles übertönende, süßliche Muff des aus Russland mitgebrachten Mottenpulvers, das Nadjeshda Iwanowna in lebensfeindlicher Konzentration verwendete."
Zitat Seite 255:
 "Pünktlich um zwei Uhr klingelte es: Charlotte und Wilhelm standen vor der Tür - mit ihren Dederon-Einkaufstaschen. Was würde wohl dieses Mal darin enthalten sein? Eine abwaschbare Tischdecke? Irgendein Kuba-Kalender?"
"Pünktlich um zwei Uhr klingelte es: Charlotte und Wilhelm standen vor der Tür - mit ihren Dederon-Einkaufstaschen. Was würde wohl dieses Mal darin enthalten sein? Eine abwaschbare Tischdecke? Irgendein Kuba-Kalender?"
Zitat Seite 260:
 "Nadjeshda Iwanowna reichte den Teller. Irina gabelte die Keule auf, aber an der Gabel blieb nur ein Stück Kruste hängen. Sie tat Nadjeshda Iwanowna die Kruste auf, um im zweiten Versuch die Keule nachzulegen - aber in diesem Augenblick zog Nadjeshda Iwanowna den Teller weg. - Ich habe schon genug! Die Keule plumpste aufs Tischtuch. - Nu tschjort poderi! Fluchen konnte Irina noch immer nur russisch. Nadjeshda Iwanowna bekreuzigte sich."
"Nadjeshda Iwanowna reichte den Teller. Irina gabelte die Keule auf, aber an der Gabel blieb nur ein Stück Kruste hängen. Sie tat Nadjeshda Iwanowna die Kruste auf, um im zweiten Versuch die Keule nachzulegen - aber in diesem Augenblick zog Nadjeshda Iwanowna den Teller weg. - Ich habe schon genug! Die Keule plumpste aufs Tischtuch. - Nu tschjort poderi! Fluchen konnte Irina noch immer nur russisch. Nadjeshda Iwanowna bekreuzigte sich."
Zitat Seite 352:
 "… die Finger taten ihr weh. Bei solchem Wetter schmerzten ihre Gelenke besonders; der Rücken, die Hände … Und wer weiß, dachte Irina, während im Radio wieder einmal von der aserbaidschanischen Region Berg-Karabach die Rede war, wo die Armenier (die Irina, und zwar nicht nur wegen ihres vorzüglichen Kognaks, für ein großes Kulturvolk hielt) heute Nacht zwanzig Zivilisten umgebracht hatten, wer weiß, dachte sie, was sie sich noch für Schäden zugezogen hatte, die Holzschutzmittel, die sie eingeatmet hatte, Der Kamilit-Staub, von dem es auf einmal hieß, dass er krebserregend sei … und alles vergeblich."
"… die Finger taten ihr weh. Bei solchem Wetter schmerzten ihre Gelenke besonders; der Rücken, die Hände … Und wer weiß, dachte Irina, während im Radio wieder einmal von der aserbaidschanischen Region Berg-Karabach die Rede war, wo die Armenier (die Irina, und zwar nicht nur wegen ihres vorzüglichen Kognaks, für ein großes Kulturvolk hielt) heute Nacht zwanzig Zivilisten umgebracht hatten, wer weiß, dachte sie, was sie sich noch für Schäden zugezogen hatte, die Holzschutzmittel, die sie eingeatmet hatte, Der Kamilit-Staub, von dem es auf einmal hieß, dass er krebserregend sei … und alles vergeblich."
Nadjeshda Iwanowna Seiten 139-159
Zitat S. 139:
 "In Slawa wurden jetzt die Kartoffeln gemacht, die ersten Feuer rauchten schon, das Kartoffelkraut brannte, und wenn erst mal das Kartoffelkraut brannte, dann war sie gekommen, unwiderruflich: die Zeit des abnehmenden Lichts."
"In Slawa wurden jetzt die Kartoffeln gemacht, die ersten Feuer rauchten schon, das Kartoffelkraut brannte, und wenn erst mal das Kartoffelkraut brannte, dann war sie gekommen, unwiderruflich: die Zeit des abnehmenden Lichts."
Zitat S. 139:
 "… dreißig Jahre war das nun her, aber noch heute hatte sie den Geruch seiner Nackenhaare in der Nase, wenn sie daran dachte, wie er auf ihrem Schoß gesessen hatte, und sie hatten Maltschik-Paltschik gespielt, stundenlang, oder sie hatte ihm etwas vorgesungen, das Lied vom Zicklein, das nicht auf die Großmutter hören wollte, das wollte er immer hören, wieder und wieder, wird es vergessen haben, der Junge, obwohl er's schon beinahe auswendig konnte mit seinen zwei Jahren, …""
"… dreißig Jahre war das nun her, aber noch heute hatte sie den Geruch seiner Nackenhaare in der Nase, wenn sie daran dachte, wie er auf ihrem Schoß gesessen hatte, und sie hatten Maltschik-Paltschik gespielt, stundenlang, oder sie hatte ihm etwas vorgesungen, das Lied vom Zicklein, das nicht auf die Großmutter hören wollte, das wollte er immer hören, wieder und wieder, wird es vergessen haben, der Junge, obwohl er's schon beinahe auswendig konnte mit seinen zwei Jahren, …""
Zitat S. 139f:
 "Nadjeshda Iwanowna schnäuzte sich und nahm das Strickzeug zur Hand, das sie irgendwann heute morgen auf dem Kopfkissen abgelegt hatte, die Socken für Sascha, dann kriegte sie eben Kurt, eine Socke war schließlich schon fertig, bei der anderen arbeitete sie sich gerade an die Ferse heran, von Socken verstand sie was, hatte schon viele Socken gestrickt, … Für die Ferse musste sie die Maschenzahl in drei Teile teilen, aber sie zählte nie nach, das machte sich irgendwie immer von selbst, dann die Maschen verschränken, und dann ging's geradeaus, immer die Nadel lang."
"Nadjeshda Iwanowna schnäuzte sich und nahm das Strickzeug zur Hand, das sie irgendwann heute morgen auf dem Kopfkissen abgelegt hatte, die Socken für Sascha, dann kriegte sie eben Kurt, eine Socke war schließlich schon fertig, bei der anderen arbeitete sie sich gerade an die Ferse heran, von Socken verstand sie was, hatte schon viele Socken gestrickt, … Für die Ferse musste sie die Maschenzahl in drei Teile teilen, aber sie zählte nie nach, das machte sich irgendwie immer von selbst, dann die Maschen verschränken, und dann ging's geradeaus, immer die Nadel lang."
Zitat Seite 141:
 "… immer nur fernsehen, man wurde ja dumm im Kopf, manchmal las sie das Buch, das Kurt ihr gegeben hatte, lesen konnte sie schließlich, hatte sich ja alphabetisiert, als sie nach Slawa kamen, wo die Sowjetischen waren, nur dass es zu dick war, das Buch, Krieg und Frieden, wenn man in der Mitte angekommen war, hatte man den Anfang schon wieder vergessen, über die Heumahd ging's, daran erinnerte sie sich, schwere Arbeit, sie hatte genug Heu gemäht in ihrem Leben, nach Feierabend, wenn sie vom Sägewerk kam, im August war die Heumahd, im September kamen dann die Kartoffeln dran, so war das gewesen in Slawa."…"
"… immer nur fernsehen, man wurde ja dumm im Kopf, manchmal las sie das Buch, das Kurt ihr gegeben hatte, lesen konnte sie schließlich, hatte sich ja alphabetisiert, als sie nach Slawa kamen, wo die Sowjetischen waren, nur dass es zu dick war, das Buch, Krieg und Frieden, wenn man in der Mitte angekommen war, hatte man den Anfang schon wieder vergessen, über die Heumahd ging's, daran erinnerte sie sich, schwere Arbeit, sie hatte genug Heu gemäht in ihrem Leben, nach Feierabend, wenn sie vom Sägewerk kam, im August war die Heumahd, im September kamen dann die Kartoffeln dran, so war das gewesen in Slawa."…"
Zitat Seite 142:
 "Jetzt klopfte es an der Tür, Kurt war's, ob sie denn mitkam nachher, zu Wilhelms Geburtstag. Herrje, heute morgen hatte sie noch dran gedacht, aber dann hatte der alte Kopf es vergessen, aber zugeben wollte sie's nicht. - Natürlich komm ich mit, sagte sie. Wie denn anders. Nur der Blumenladen am Friedhof hatte längst zu, äch ty, rastjopa, was nun, eine Schachtel Pralinen hatte sie noch, hoffentlich nicht von Charlotte und Wilhelm, die schenkten ihr immer Pralinen, obwohl sie gar keine aß, aber schaden tat's nix, …"
"Jetzt klopfte es an der Tür, Kurt war's, ob sie denn mitkam nachher, zu Wilhelms Geburtstag. Herrje, heute morgen hatte sie noch dran gedacht, aber dann hatte der alte Kopf es vergessen, aber zugeben wollte sie's nicht. - Natürlich komm ich mit, sagte sie. Wie denn anders. Nur der Blumenladen am Friedhof hatte längst zu, äch ty, rastjopa, was nun, eine Schachtel Pralinen hatte sie noch, hoffentlich nicht von Charlotte und Wilhelm, die schenkten ihr immer Pralinen, obwohl sie gar keine aß, aber schaden tat's nix, …"
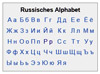 Zitat Seite 142f:
Zitat Seite 142f:
"Ein guter Mann, Kurt, immer höflich, immer mit Vor- und Vatersnamen, Ira konnte von Glück reden, dass sie so einen gefunden hatte, dachte Nadeshda Iwanowna, …"
Zitat Seite 144:
 "… als Kind hatte sie immer Ausschau gehalten nach solchen Schuhen, wenn sie in irgendein Dorf kamen und sie vor der Kirche saß, gehasst hatte sie das, die beiden Großen durften sich Arbeit suchen im Dorf, und sie, die Kleinste, musste die Hand aufhalten, den ganzen Tag lang, Kopf runter, Hand hoch, aber wenn keine Schuhe in Sicht waren, konnte man die Hand auch mal runternehmen, das hatte sie rasch kapiert, Fußlappenbrachten nix, Bastschuhe hin und wieder, aber sobald irgendwo Schuhe auftauchten, da hieß es Achtung, richtige, lederne Schuhe …"
"… als Kind hatte sie immer Ausschau gehalten nach solchen Schuhen, wenn sie in irgendein Dorf kamen und sie vor der Kirche saß, gehasst hatte sie das, die beiden Großen durften sich Arbeit suchen im Dorf, und sie, die Kleinste, musste die Hand aufhalten, den ganzen Tag lang, Kopf runter, Hand hoch, aber wenn keine Schuhe in Sicht waren, konnte man die Hand auch mal runternehmen, das hatte sie rasch kapiert, Fußlappenbrachten nix, Bastschuhe hin und wieder, aber sobald irgendwo Schuhe auftauchten, da hieß es Achtung, richtige, lederne Schuhe …"
Zitat Seite 146:
 "Und dann mussten sie ziehen, die ‚Unruhestifter', mitten im Winter, immerhin gab ihnen der Kulak noch ein viertel Pud Brot, das wusste sie noch, und wie die Leute hinter den Fenstern standen und schauten, und dann - wusste sie nicht mehr."
"Und dann mussten sie ziehen, die ‚Unruhestifter', mitten im Winter, immerhin gab ihnen der Kulak noch ein viertel Pud Brot, das wusste sie noch, und wie die Leute hinter den Fenstern standen und schauten, und dann - wusste sie nicht mehr."
Zitat Seite 146f:
 "Draußen heulte der Wind, oder, wenn es ganz still war, dann heulten die Wölfe, weit entfernt, so schien es, aber wenn der Winter lange genug gedauert hatte, dann kamen sie, schlichen zwischen den Häusern von Gríschkin Nagár umher, und wenn man am Morgen die Tür aufmachte, fand man im Schnee ihre Spuren. Im Sommer waren sie feige, da wurde man eher von den Mücken gefressen als von den Wölfen, halb tot musste man sein, ehe sie einen anfielen, sagten die Männer, wahrscheinlich war sie schon halb verrückt gewesen vor Durst, wer weiß, wie lange sie schon herumgeirrt war, wer sich verlief, lief im Kreis, so hieß es, gefunden hatte man sie in einer Entfernung von zwölf oder fünfzehn Werst, zwei
"Draußen heulte der Wind, oder, wenn es ganz still war, dann heulten die Wölfe, weit entfernt, so schien es, aber wenn der Winter lange genug gedauert hatte, dann kamen sie, schlichen zwischen den Häusern von Gríschkin Nagár umher, und wenn man am Morgen die Tür aufmachte, fand man im Schnee ihre Spuren. Im Sommer waren sie feige, da wurde man eher von den Mücken gefressen als von den Wölfen, halb tot musste man sein, ehe sie einen anfielen, sagten die Männer, wahrscheinlich war sie schon halb verrückt gewesen vor Durst, wer weiß, wie lange sie schon herumgeirrt war, wer sich verlief, lief im Kreis, so hieß es, gefunden hatte man sie in einer Entfernung von zwölf oder fünfzehn Werst, zwei  Jahre später, den Zinkeimer brachte man, mit dem sie zum Beerensammeln gegangen war, und in dem Eimer, frag lieber nicht, noch heute bekam sie Gänsehaut, wenn sie dran dachte, was von ihr übrig geblieben war, Hörnlein und Hufen, nun weißt du, warum, zweimal drehst du dich, zweimal streckst du dich nach den Beeren, schon hast du die Lichtung verloren, groß ist die Taiga, und schnell verliert man die Richtung, und dann merk es dir wohl, was übrig geblieben ist von dem Zicklein, nur Hörnlein und Hufen, vergeblich gerufen, nur Hörnlein …"
Jahre später, den Zinkeimer brachte man, mit dem sie zum Beerensammeln gegangen war, und in dem Eimer, frag lieber nicht, noch heute bekam sie Gänsehaut, wenn sie dran dachte, was von ihr übrig geblieben war, Hörnlein und Hufen, nun weißt du, warum, zweimal drehst du dich, zweimal streckst du dich nach den Beeren, schon hast du die Lichtung verloren, groß ist die Taiga, und schnell verliert man die Richtung, und dann merk es dir wohl, was übrig geblieben ist von dem Zicklein, nur Hörnlein und Hufen, vergeblich gerufen, nur Hörnlein …"
 Zitat Seite 147:
Zitat Seite 147:
"… oder sie schenkte Wilhelm die Gurken, gute Gurken, uralische Art, mit Knoblauch und Dill, Sascha war immer ganz wild gewesen auf ihre Gurken, allerdings, ob's zum Geburtstag das Richtige war, sie würde Kurt fragen …"
Zitat Seite 149:
 "Wahrscheinlich kam's daher, weil sie keinen Vater gehabt hatte, Großmutter Marfa hatte sie natürlich verwöhnt, zuerst hieß es: Schande, Schande, ein Kind von dem Schwarzen, der Schwarze hatte sie immer gesagt, der ‚Zigan', dabei war er überhaupt kein Zigan, Händler war er gewesen, Petroleum hatten sie bei ihm gekauft, ein guter Mann war's, Pjotr Ignatjewitsch, kein Trinker, nicht wie die Mushiks in Gríschkin Nagár, ein Herr war's, beinahe, mit seinem Mantel und seinen Manieren, drei Pferde vor seinem Wagen, so viel gab es im ganzen Dorf nicht, und wenn es auch Sünde gewesen war, und sie bat Gott um Vergebung, aber insgeheim fühlte sie sich unschuldig, denn wäre nicht Mutter Marfa davor gewesen, dann hätten sie sich vor Gott und der Kirche getraut, er hatte es ihr versprochen, auf Ehrenwort."
"Wahrscheinlich kam's daher, weil sie keinen Vater gehabt hatte, Großmutter Marfa hatte sie natürlich verwöhnt, zuerst hieß es: Schande, Schande, ein Kind von dem Schwarzen, der Schwarze hatte sie immer gesagt, der ‚Zigan', dabei war er überhaupt kein Zigan, Händler war er gewesen, Petroleum hatten sie bei ihm gekauft, ein guter Mann war's, Pjotr Ignatjewitsch, kein Trinker, nicht wie die Mushiks in Gríschkin Nagár, ein Herr war's, beinahe, mit seinem Mantel und seinen Manieren, drei Pferde vor seinem Wagen, so viel gab es im ganzen Dorf nicht, und wenn es auch Sünde gewesen war, und sie bat Gott um Vergebung, aber insgeheim fühlte sie sich unschuldig, denn wäre nicht Mutter Marfa davor gewesen, dann hätten sie sich vor Gott und der Kirche getraut, er hatte es ihr versprochen, auf Ehrenwort."
Zitat Seite 150:
 "... Nein, nein, korrigierte ihn Nadjeshda Iwanowna, ich weiß es ja noch, das war, als der Vetter die Kühe geschlachtet hat, weil es hieß, wer mehr als drei Kühe hat, wird entkulakisiert, und dann haben sie ihn trotzdem entkulakisiert, weil er die Kühe geschlachtet hat. - Sie meinen, sie haben ihn erschossen. - Werden ihn wohl erschossen haben, ist lange her."
"... Nein, nein, korrigierte ihn Nadjeshda Iwanowna, ich weiß es ja noch, das war, als der Vetter die Kühe geschlachtet hat, weil es hieß, wer mehr als drei Kühe hat, wird entkulakisiert, und dann haben sie ihn trotzdem entkulakisiert, weil er die Kühe geschlachtet hat. - Sie meinen, sie haben ihn erschossen. - Werden ihn wohl erschossen haben, ist lange her."
Zitat Seite 157:
 "Das Erste, was Charlotte im Hause wahrnahm, war die stickige Luft, die sich wie ein alter Lappen auf ihre Lungen legte. Den Grund dafür erkannte sie, als sie die Treppe zum Badezimmer hinaufstieg: Mählich und Schlinger, jeder einen Pinsel in der Hand, machten sich im oberen Flur an einem großen Plakat zu schaffen und hatten - offenbar um beim Malen eine glatte Unterlage zu haben - den langen Läufer zusammengerollt. Die Luft war von Staub erfüllt. - Was macht ihr denn da, fauchte Charlotte. - Wilhelm hat gesagt, begann Mählich … - Wilhelm hat gesagt, Wilhelm hat gesagt, presste Charlotte heraus. Im Bad nahm sie eine Prednisolon. Nach dem Duschen drückte sie sich ein feuchtes Handtuch vor den Mund, um über den Flur zu kommen."
"Das Erste, was Charlotte im Hause wahrnahm, war die stickige Luft, die sich wie ein alter Lappen auf ihre Lungen legte. Den Grund dafür erkannte sie, als sie die Treppe zum Badezimmer hinaufstieg: Mählich und Schlinger, jeder einen Pinsel in der Hand, machten sich im oberen Flur an einem großen Plakat zu schaffen und hatten - offenbar um beim Malen eine glatte Unterlage zu haben - den langen Läufer zusammengerollt. Die Luft war von Staub erfüllt. - Was macht ihr denn da, fauchte Charlotte. - Wilhelm hat gesagt, begann Mählich … - Wilhelm hat gesagt, Wilhelm hat gesagt, presste Charlotte heraus. Im Bad nahm sie eine Prednisolon. Nach dem Duschen drückte sie sich ein feuchtes Handtuch vor den Mund, um über den Flur zu kommen."
Kurt Seiten 160-186, 290-306, 323-350
Zitat Seite 161:
 "Nun war er wieder in Moskau gewesen. Und obwohl ihm die Stadt noch nie so dreckig, so roh, so anstrengend erschienen war wie bei diesem Besuch - die langen Wege, die Betrunkenen, die allgegenwärtigen ‚Diensthabenden' mit ihren griesgrämigen Gesichtern, sogar die berühmte Metro, auf die er immer ein bisschen stolz gewesen war, weil er als junger Mann bei Subbotniks an ihrem Bau teilgenommen hatte, alles war ihm auf die Nerven gegangen: die Enge, der Lärm, das guillotineartige Zuschnappen der automatischen Türen (und wieso eigentlich lag diese verdammte Metro fast hundert Meter unter der Erde, und wieso, noch erstaunlicher, hatte er sich das damals nicht gefragt) …"
"Nun war er wieder in Moskau gewesen. Und obwohl ihm die Stadt noch nie so dreckig, so roh, so anstrengend erschienen war wie bei diesem Besuch - die langen Wege, die Betrunkenen, die allgegenwärtigen ‚Diensthabenden' mit ihren griesgrämigen Gesichtern, sogar die berühmte Metro, auf die er immer ein bisschen stolz gewesen war, weil er als junger Mann bei Subbotniks an ihrem Bau teilgenommen hatte, alles war ihm auf die Nerven gegangen: die Enge, der Lärm, das guillotineartige Zuschnappen der automatischen Türen (und wieso eigentlich lag diese verdammte Metro fast hundert Meter unter der Erde, und wieso, noch erstaunlicher, hatte er sich das damals nicht gefragt) …"
Zitat Seite 162:
 "Der berühmte Jerusalimski hatte sich begeistert gezeigt über sein neues Buch, hatte ihn überall als den Experten auf seinem Gebiet vorgestellt und am Ende sogar persönlich einer Stadtrundfahrt mit ihm unternommen, und Kurt hatte eine diebische Freude dabei empfunden, sich nicht anmerken zu lassen, wie gut er das alles kannte: die Manjeshnaja, das Hotel Metropol und ach, sieh mal an, die Lubjanka ..."
"Der berühmte Jerusalimski hatte sich begeistert gezeigt über sein neues Buch, hatte ihn überall als den Experten auf seinem Gebiet vorgestellt und am Ende sogar persönlich einer Stadtrundfahrt mit ihm unternommen, und Kurt hatte eine diebische Freude dabei empfunden, sich nicht anmerken zu lassen, wie gut er das alles kannte: die Manjeshnaja, das Hotel Metropol und ach, sieh mal an, die Lubjanka ..."
Zitat Seite 164:
 "Sascha hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Früher hätte er keine Gelegenheit ausgelassen, zum Flughafen mitzufahren, aber die Phase, wo er Flugzeugkonstrukteur werden wollte, war vorbei. Stattdessen nahm er jetzt mit dem Tonbandgerät neumodische Musik im RIAS auf und trieb sich bis in die Dämmerung mit zweifelhaften Freunden herum, darunter ein frühreifes Mädchen aus der Parallelklasse, das aus halb asozialen Verhältnissen stammte und jetzt schon, mit zwölf, einen ansehnlichen Busen unter dem schmuddelig blauen Pullover trug."
"Sascha hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Früher hätte er keine Gelegenheit ausgelassen, zum Flughafen mitzufahren, aber die Phase, wo er Flugzeugkonstrukteur werden wollte, war vorbei. Stattdessen nahm er jetzt mit dem Tonbandgerät neumodische Musik im RIAS auf und trieb sich bis in die Dämmerung mit zweifelhaften Freunden herum, darunter ein frühreifes Mädchen aus der Parallelklasse, das aus halb asozialen Verhältnissen stammte und jetzt schon, mit zwölf, einen ansehnlichen Busen unter dem schmuddelig blauen Pullover trug."
Zitat Seite 164:
 "Und dass er einsam gewesen war zwischen all den wohlgesinnten Menschen, von denen er keinen so gut kannte, dass er es gewagt hätte, die Fragen, die ihn beunruhigten, auch nur anzutippen - zum Beispiel die Frage, inwieweit, nach Ansicht seiner Kollegen, eine Re-Stalinisierung der Sowjetunion drohte, nachdem der tölpelhafte, aber doch irgendwie sympathische Reformer Nikita Chruschtschow (ohne den er, Kurt, noch immer als "Ewig-Verbannter" hinterm Ural säße) als Parteichef abgelöst worden war. - Und ich war auf dem Nowodewitschi, sagte er."
"Und dass er einsam gewesen war zwischen all den wohlgesinnten Menschen, von denen er keinen so gut kannte, dass er es gewagt hätte, die Fragen, die ihn beunruhigten, auch nur anzutippen - zum Beispiel die Frage, inwieweit, nach Ansicht seiner Kollegen, eine Re-Stalinisierung der Sowjetunion drohte, nachdem der tölpelhafte, aber doch irgendwie sympathische Reformer Nikita Chruschtschow (ohne den er, Kurt, noch immer als "Ewig-Verbannter" hinterm Ural säße) als Parteichef abgelöst worden war. - Und ich war auf dem Nowodewitschi, sagte er."
Zitat Seite 171:
 "Die Angelegenheit war ebenso einfach wie dumm. Paul Rohde, ein immer schon etwas übermütiger und nicht immer disziplinierter Mitarbeiter aus Kurts Arbeitsgruppe, hatte in der ZfG das Buch eines westdeutschen Kollegen besprochen, in dem die sogenannte Einheitsfrontpolitik der KPD Ende der zwanziger Jahre kritisch beleuchtet wurde (welche, wie jedem klar war, in Wirklichkeit natürlich eine Spalterpolitik gewesen war, die die Sozialdemokratie verunglimpft und das Erstarken des Faschismus auf schlimmste Weise befördert hatte!), und dann hatte Rohde dem westdeutschen Kollegen persönlich seine Rezension geschickt, versehen mit der Bemerkung, er möge entschuldigen, dass sie so negativ sei, die gesamte Arbeitsgruppe finde das Buch klug und interessant, aber in der DDR sei es leider noch längst nicht so weit, dass das Thema Einheitsfrontpolitik offen diskutiert werden könne ..."
"Die Angelegenheit war ebenso einfach wie dumm. Paul Rohde, ein immer schon etwas übermütiger und nicht immer disziplinierter Mitarbeiter aus Kurts Arbeitsgruppe, hatte in der ZfG das Buch eines westdeutschen Kollegen besprochen, in dem die sogenannte Einheitsfrontpolitik der KPD Ende der zwanziger Jahre kritisch beleuchtet wurde (welche, wie jedem klar war, in Wirklichkeit natürlich eine Spalterpolitik gewesen war, die die Sozialdemokratie verunglimpft und das Erstarken des Faschismus auf schlimmste Weise befördert hatte!), und dann hatte Rohde dem westdeutschen Kollegen persönlich seine Rezension geschickt, versehen mit der Bemerkung, er möge entschuldigen, dass sie so negativ sei, die gesamte Arbeitsgruppe finde das Buch klug und interessant, aber in der DDR sei es leider noch längst nicht so weit, dass das Thema Einheitsfrontpolitik offen diskutiert werden könne ..."
Zitat Seite 295:
 "Sie standen vor der Goldbroilergaststätte Ecke Milastraße. Kurt hatte weder Lust auf Broiler, noch hatte er Lust auf Neonlicht und Tische ausSprelacart, aber vor allem hatte er keine Lust, in der Kälte anzustehen: Die Schlange ging bis vor die Tür."
"Sie standen vor der Goldbroilergaststätte Ecke Milastraße. Kurt hatte weder Lust auf Broiler, noch hatte er Lust auf Neonlicht und Tische ausSprelacart, aber vor allem hatte er keine Lust, in der Kälte anzustehen: Die Schlange ging bis vor die Tür."
Zitat Seite 297:
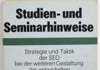 "Kurt musste plötzlich an das Parteilehrjahr heute nachmittag denken, eine dämliche Pflichtveranstaltung, die, obwohl sie Parteilehrjahr hieß, einmal im Monat durchgeführt wurde."
"Kurt musste plötzlich an das Parteilehrjahr heute nachmittag denken, eine dämliche Pflichtveranstaltung, die, obwohl sie Parteilehrjahr hieß, einmal im Monat durchgeführt wurde."
Zitat Seite 297:
 " - Kenn' Se den, flüsterte der andere Mann - offenbar von so viel Zustimmung ermuntert: Wat sin' die vier Hauptfeinde des Sozialismus? Das Paar wechselte Blicke. - Frühjah, Somma, Herbst und Winta, sagte der Mann und kicherte in sich hinein. Das Paar wechselte Blicke. Sascha lachte. Kurt kannte den Witz schon: Günther hatte ihn vor der Parteiversammlung erzählt."
" - Kenn' Se den, flüsterte der andere Mann - offenbar von so viel Zustimmung ermuntert: Wat sin' die vier Hauptfeinde des Sozialismus? Das Paar wechselte Blicke. - Frühjah, Somma, Herbst und Winta, sagte der Mann und kicherte in sich hinein. Das Paar wechselte Blicke. Sascha lachte. Kurt kannte den Witz schon: Günther hatte ihn vor der Parteiversammlung erzählt."
Zitat Seite 303:
 "Tatsächlich stand am Taxistand neben dem Bahnhof ein freies Taxi. Kurt kroch in den Fond des Wagens. Es war ein Wolga, ein breites Gefährt mit weichen Sitzen, das, wie alle Russenautos, nach Russenauto roch - ein Geruch, der ihn immer ein bisschen an Moskau erinnerte: Schon die alten Pobeda-Taxen hatten so gerochen."
"Tatsächlich stand am Taxistand neben dem Bahnhof ein freies Taxi. Kurt kroch in den Fond des Wagens. Es war ein Wolga, ein breites Gefährt mit weichen Sitzen, das, wie alle Russenautos, nach Russenauto roch - ein Geruch, der ihn immer ein bisschen an Moskau erinnerte: Schon die alten Pobeda-Taxen hatten so gerochen."
Zitat Seite 304:
 "Sie standen jetzt vor der Weltzeituhr. In New York war es halb eins, in Rio halb vier. Ringsum ein paar verfrorene Gestalten, die sich leichtsinnigerweise trotz der Kälte hier verabredet hatten: war ein beliebter Treffpunkt, die Weltzeituhr, als spürte man hier etwas von der großen, weiten Welt."
"Sie standen jetzt vor der Weltzeituhr. In New York war es halb eins, in Rio halb vier. Ringsum ein paar verfrorene Gestalten, die sich leichtsinnigerweise trotz der Kälte hier verabredet hatten: war ein beliebter Treffpunkt, die Weltzeituhr, als spürte man hier etwas von der großen, weiten Welt."
Zitat Seite 304:
 " - Dort ist auf, sagte Sascha. Lass uns reingehen. Ich frier mir den Arsch ab sonst. Was Sascha meinte, war die Selbstbedienungsgaststätte im Erdgeschoss vom Alexanderhaus. Kurt war ein einziges Mal dort gewesen. Vor zehn Jahren, als das Restaurant eröffnet wurde, war es der letzte Schrei gewesen. Inzwischen hatte sich eine ranzige Patina über alles gelegt. … Aus einer Reihe von Automaten konnte man kalte Speisen ziehen. Auf einem Metalltresen stand heißer Kesselgulasch, fünfundachtzig Pfennig."
" - Dort ist auf, sagte Sascha. Lass uns reingehen. Ich frier mir den Arsch ab sonst. Was Sascha meinte, war die Selbstbedienungsgaststätte im Erdgeschoss vom Alexanderhaus. Kurt war ein einziges Mal dort gewesen. Vor zehn Jahren, als das Restaurant eröffnet wurde, war es der letzte Schrei gewesen. Inzwischen hatte sich eine ranzige Patina über alles gelegt. … Aus einer Reihe von Automaten konnte man kalte Speisen ziehen. Auf einem Metalltresen stand heißer Kesselgulasch, fünfundachtzig Pfennig."
Zitat Seite 305:
 "Sie passierten den Schacht zwischen dem großen Hotel und dem Warenhaus und gingen dann, ohne dass Kurt hätte sagen können, warum und wohin, quer über die Fläche, wo der Wind sie in Wirbeln und Stößen attackierte und ihnen Tränen in die Augen trieb."
"Sie passierten den Schacht zwischen dem großen Hotel und dem Warenhaus und gingen dann, ohne dass Kurt hätte sagen können, warum und wohin, quer über die Fläche, wo der Wind sie in Wirbeln und Stößen attackierte und ihnen Tränen in die Augen trieb."
Zitat Seite 341:
 "Noch 1932, erinnerte sich Kurt, schon wieder klatschend (nämlich nachdem Wilhelm der Vaterländische Verdienstorden in Gold angesteckt worden war) - noch 1932 hatte Wilhelm als zweiter Gauleiter des RFB in Berlin eine große, gemeinsame Aktion von Nazis und Kommunisten mitorganisiert."
"Noch 1932, erinnerte sich Kurt, schon wieder klatschend (nämlich nachdem Wilhelm der Vaterländische Verdienstorden in Gold angesteckt worden war) - noch 1932 hatte Wilhelm als zweiter Gauleiter des RFB in Berlin eine große, gemeinsame Aktion von Nazis und Kommunisten mitorganisiert."
Zitat Seite 348:
 "Er überquerte die sogenannte Lange Brücke, passierte Fahrbahn und Schienen, bog am Interhotel ab und kam über die Wilhelm-Külz-Straße zur Leninallee, Potsdams längster, wenn auch gewiss nicht schönster Straße."
"Er überquerte die sogenannte Lange Brücke, passierte Fahrbahn und Schienen, bog am Interhotel ab und kam über die Wilhelm-Külz-Straße zur Leninallee, Potsdams längster, wenn auch gewiss nicht schönster Straße."
Zitat Seite 350:
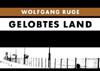 "Es gab nichts mehr zu bedenken. Es gab keinen Grund seine Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden: Rezensionen für die ZfG, ND-Artikel anlässlich irgendwelcher historischer Jubiläen … und sogar die Mitarbeit an dem Sammelband, der, da er Beiträge aus Ost und West enthalten sollte, mit einer durchaus verlockenden Konferenz in Saarbrücken verbunden war, würde er - am besten aus gesundheitlichen Gründen - absagen und sich gleich morgen früh an den Schreibtisch setzen und anfangen, seineErinnerungen zu schreiben, und zwar (auch das wusste er sofort) beginnend mit jenem Augusttag 1936, an dem er neben Werner an Deck des Fährschiffes stand und zusah, wie der Leuchttum von Warnemünde im frühen Nebel verblasste."
"Es gab nichts mehr zu bedenken. Es gab keinen Grund seine Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden: Rezensionen für die ZfG, ND-Artikel anlässlich irgendwelcher historischer Jubiläen … und sogar die Mitarbeit an dem Sammelband, der, da er Beiträge aus Ost und West enthalten sollte, mit einer durchaus verlockenden Konferenz in Saarbrücken verbunden war, würde er - am besten aus gesundheitlichen Gründen - absagen und sich gleich morgen früh an den Schreibtisch setzen und anfangen, seineErinnerungen zu schreiben, und zwar (auch das wusste er sofort) beginnend mit jenem Augusttag 1936, an dem er neben Werner an Deck des Fährschiffes stand und zusah, wie der Leuchttum von Warnemünde im frühen Nebel verblasste."
Wilhelm Seiten 187-208
 Zitat Seite 196:
Zitat Seite 196:
"Wer weiß, was sie ihm für Zeug gab. Auch Stalin hatte man ja vergiftet."
 Zitat Seite 197:
Zitat Seite 197:
"Es klingelte, draußen stand der Pionierchor. Die Pionierleiterin sagte: Drei vier, und der Chor sang das Lied vom kleinen Trompeter. Schönes Lied, aber nicht das, was er meinte. Nicht das, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf ging."
Zitat Seite 202:
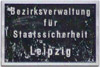 "So einer war nun Oberst bei der Staatssicherheit - während man ihn, Wilhelm, damals nicht übernommen hatte: Westemigrant! Bis heute kränkte es ihn. Auch er wäre lieber in Moskau geblieben. Aber die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt, und er hatte getan, was die Partei von ihm verlangte. Sein Leben lang hatte er getan, was die Partei von ihm verlangte, und dann: Westemigrant!, sagte er."
"So einer war nun Oberst bei der Staatssicherheit - während man ihn, Wilhelm, damals nicht übernommen hatte: Westemigrant! Bis heute kränkte es ihn. Auch er wäre lieber in Moskau geblieben. Aber die Partei hatte ihn nach Deutschland geschickt, und er hatte getan, was die Partei von ihm verlangte. Sein Leben lang hatte er getan, was die Partei von ihm verlangte, und dann: Westemigrant!, sagte er."
 Zitat S. 203:
Zitat S. 203:
"Aha, der Genosse Krüger. Abschnittsbevollmächtigter. - In Uniform hätte ich dich erkannt, Genosse."
Zitat S. 204:
 "Wilhelm wühlte in seinem Gedächtnis. Zu lang war es her, dass er in Moskau gewesen war, damals zur Ausbildung bei der OMS, und das einzige Wort, das er unter den Trümmern seines Russischs noch auffand, war garosch: gut, hervorragend."
"Wilhelm wühlte in seinem Gedächtnis. Zu lang war es her, dass er in Moskau gewesen war, damals zur Ausbildung bei der OMS, und das einzige Wort, das er unter den Trümmern seines Russischs noch auffand, war garosch: gut, hervorragend."
 Zitat S. 208:
Zitat S. 208:
"Er sang leise, für sich, jede Silbe betonend. In leicht schleppendem Rhythmus, er merkte es wohl. In einem nicht beabsichtigten Tremolo in der Stimme:
Die Partei, die Partei, die hat immer recht
Und, Genossen, es bleibe dabei
Denn wer kämpft für das Recht
Der hat immer recht
Gegen Lüge und Ausbeuterei
Wer das Leben beleidigt
Ist dumm oder schlecht
Wer die Menschheit verteidigt
Hat immer recht
So, aus Lenin'schem Geist
Wächst, von Stalin geschweißt
Die Partei - die Partei - die Partei."
Markus Seiten 269-289, 371-388
Stammbaum der Familie Powileit/Umnitzer:
Die im Buch genannten Personen der Familie:
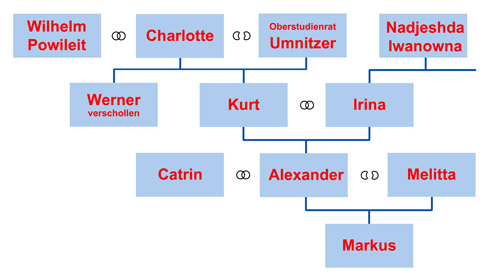
Neuendorf
Der Ort, den Ruge in seinem Roman ‚Neuendorf' nennt, ist nicht eindeutig zu bestimmen:
Die am Beginn des Romans genannte A 115 ist im Süden Berlins zu finden, eine der Beschreibung nahekommende Autobahnabfahrt wäre Kleinmachnow.

Eine Straße ‚Am Fuchsbau' ist in vielen Gemeinden in und um Berlin nachzuweisen, so auch in Kleinmachnow, noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft von einer ‚Thälmannstraße'.
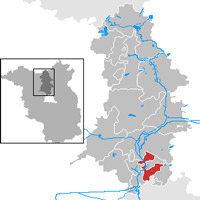
Andererseits ist eine Ortschaft, auf die Charakteristika zutreffen, die im Roman erwähnt werden, die Stadt Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel im Land Brandenburg. Die Stadt mit gut 24.400 Einwohnern liegt an der Havel und grenzt unmittelbar an den Berliner Bezirk Reinickendorf mit dem Ortsteil Frohnau und Glienicke/Nordbahn.
Mit dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wurden die Straßen- und Eisenbahnverbindungen zum südlich angrenzenden West-Berlin durch die DDR unterbrochen. Ab November desselben Jahres fuhr die S-Bahn auf einer teilweise neuen Strecke über Blankenburg nach Berlin. Durch die neuen Bahnanlagen wurde die alte Straße vom ehemaligen Bahnhof Stolpe nach Bergfelde unterbrochen. Nach dem Mauerbau wurde der Ort von seiner bisherigen Verkehrsanbindung abgeschnitten und erhielt daher 1962 einen S-Bahn-Anschluss.
Ernst Thälmann
Ernst Thälmann, 1932 Ernst Fritz Johannes Thälmann (* 16. April 1886 in Altona; † 18. August 1944 im KZ Buchenwald) war von 1924 bis 1933 Mitglied des Reichstages der Weimarer Republik, sowie von 1925 bis 1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Er trat für die KPD 1925 und 1932 als Kandidat für die Reichspräsidentenwahlen an. 1933 wurde er von der Gestapo verhaftet und nach elf Jahren Isolationshaft 1944 auf direkten Befehl Adolf Hitlers erschossen.

Neben der Benennung von Einheiten der Internationalen Brigaden (siehe Thälmann-Bataillon) nach Ernst Thälmann noch zu seinen Lebzeiten wurde 1948 in der SBZ die "Pionierorganisation Ernst Thälmann" gegründet, der dieser Name 1952 offiziell verliehen wurde. Pioniere der älteren Jahrgänge (etwa zehn bis 14 Jahre) wurden "Thälmann-Pioniere" genannt.
Viele Arbeitskollektive, Schulen, Straßen, Plätze, Orte bzw. Siedlungen und Betriebe in der DDR, wie als eines der bekanntesten Beispiele der VEB SKET (Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann) oder die Offiziershochschule der Landstreitkräfte der NVA, trugen ebenfalls seinen Namen. Auch wurde die Ernst-Thälmann-Insel in der kubanischen Schweinebucht nach ihm benannt. 1949 wurde der Berliner Wilhelmplatz in Ernst-Thälmann-Platz umbenannt. Auch die angrenzende U-Bahn-Station bekam den Namen Thälmannplatz. In den 1980er Jahren wurde in Berlin im Prenzlauer Berg der Ernst-Thälmann-Park angelegt, dazu wurde ein großes Ernst-Thälmann-Denkmal des sowjetischen Bildhauers Lew Kerbel errichtet.
Auch in Hamburg wurde eine Straße nach ihm benannt. Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes in Budapest 1956 wurde die Straße allerdings in Budapester Straße umbenannt, da man in dieser Zeit keine westdeutsche Straße nach Kommunisten benannt haben wollte. Jedoch gibt es die "Gedenkstätte Ernst Thälmann" in seinem Wohnhaus am heutigen Ernst-Thälmann-Platz in Hamburg-Eppendorf. Seit dem 24. Juli 2009 erinnert vor seinem letzten Wohnhaus in der Tarpenbekstraße in Hamburg-Eppendorf ein Stolperstein an Ernst Thälmann. Quelle: www.wikipedia.de
Rückübertragung
Als "offene Vermögensfrage" bezeichnete man zunächst die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ungelöste Frage, wie die Enteignungen in der DDR zu behandeln sind, soweit Vermögen von Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland betroffen ist.

Im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung hat die DDR mit dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen eine Regelung getroffen, die in der Regel eine Rückübertragung des enteigneten Vermögens vorsah.
Anfang der 1970er Jahre war die DDR besonders um diplomatische Anerkennung bemüht, was 1972 im besonderen Verhältnis der DDR zur Bundesrepublik zum "Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland (Grundlagenvertrag)" führte. Die Behandlung des enteigneten Vermögens wurde damals nicht geregelt. Der Verhandlungsführer der DDR, Staatssekretär Michael Kohl, hielt in einem einseitigen "Protokollvermerk zum Vertrag" vom 21. Dezember 1972 fest: "Wegen der unterschiedlichen Rechtspositionen zu Vermögensfragen konnten diese durch den Vertrag nicht geregelt werden."
In der Folgezeit hat die DDR mit anderen Staaten vertragliche Vereinbarungen über die vermögensrechtlichen Fragen getroffen. Diese Abkommen sahen pauschale Abfindungen der DDR an die jeweiligen Vertragspartnerstaaten vor. Die Vertragspartnerstaaten verteilten die Abfindungen in eigener Verantwortung an die enteignungsbetroffenen Bürger.
Zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland kam jedoch ein solches Abkommen zunächst nicht zustande. Erst im Zuge der Wiedervereinigung einigten sich die beiden deutschen Staaten grundsätzlich über die Behandlung offener Vermögensfragen. Im Gegensatz zu den Entschädigungsregelungen mit anderen Staaten vereinbarten die beiden deutschen Staaten eine grundsätzliche Rückübertragung des enteigneten Vermögens. Die Siegermächte des zweiten Weltkriegs stimmten am 12. September 1990 in den "Zwei-plus-Vier-Gesprächen" zu. Quelle: www.wikipedia.de
Igelit
Igelit ist ein ehemals eingetragener Handelsname für Weich-PVC, insbesondere eines Copolymerisates mit z. B. 20 % Acrylsäureester bei 80 % Vinylchlorid. Außerdem wurde noch der Weichmacher Trikresylphosphat (TKP) mit bis 30 % Anteil zugesetzt.
Der Name spielt an auf den Inhaber der Namensrechte, die I.G. Farbenindustrie A.G. Er wurde von den Nachfolgern der IG-Farben bis in die Nachkriegszeit benutzt, musste dann aber, wie andere Handelsnamen mit den Anfangsbuchstaben IG-, im Zuge der Liquidation von I.G. Farben aufgegeben werden.

Produktionsgeschichte
1938 nahm das Werk Bitterfeld mit einer Monatsproduktion von 120 Tonnen die Fertigung auf. In der DDR produzierten es die vormaligen IG-Farbenwerke VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld und die Buna-Werke Schkopau in großen Mengen.
Das Material diente u. a. als Lederersatz für Schuhmaterial und Taschen, für Regenmäntel ("Hast du Igelit im Haus, kannst du auch bei Regen raus"), als Fußbodenauslegware minderer Qualität und auch als Verpackungsmaterial. In der DDR war es vor allem als Schuhmaterial berüchtigt ("Im Sommer heiß, im Winter kalt").
Es konnte durch Abgabe von Orthotrikresylphosphat (OTKP) aus seinem Weichmacher Nervenlähmungen verursachen. Daher wurde seine Verwendung in der DDR bereits 1950 durch eine Verordnung stark eingeschränkt, die u. a. ein Verbot der Verwendung im Nahrungsmittel- und Hygienebereich sowie die Verpflichtung einer Gefahrenkennzeichnung an entsprechenden Produkten beinhaltete.
Allerdings wurde erst im Juli oder August 1952 die Herstellung der sogenannten Bino-Produkte, das waren Suppenwürze und Brühwürfel, die aus Abfallprodukten der Igelit-Herstellung gewonnen wurden, durch das Gesundheitsministerium von Sachsen-Anhalt verboten. Das Bayerische Innenministerium ordnete in der Folge die Einziehung sämtlicher in Bayern vorhandener Bestände an. Quelle: Wikipedia
Schultasche aus Igelit
Dies ist meine alte Schultasche. Sie riecht durchdringend. Und so wie meine Tasche riecht, roch es in der Reichsbahn, im Osten - so roch der Osten. Der Geruch stammt von diesem Ostmaterial: Igelit nannte sich das, dieses unverwüstliche Zeug. Renate K., geb. 1932, aus Magdeburg/Deutschland Quelle: migrant.ch
Gojko Mitic
Biografie Der Schauspieler Gojko Mitic wurde am 13. Juni 1940 im serbischen Leskovac geboren. Mit zwanzig Jahren begann er ein Sportstudium in Belgrad und trat ab 1961 eher zufällig als Komparse und Stuntdouble in verschiedenen britischen und italienischen Filmproduktionen, unter anderem im Kostümfilm "Lancelot", auf. Erste kleinere Rollen erhielt er 1963/1964 als Apachenkrieger in "Old Shatterhand" sowie als Weißer Rabe in "Winnetou".

Eine größere Episodenrolle folgte kurz darauf als Wokadeh im Winnetou-Film "Unter Geiern". Als die DEFA 1965 in Jugoslawien ihren ersten Indianerfilm "Die Söhne der Großen Bärin" inszenierte, wurde Gojko Mitic für die Hauptrolle des Häuptlings ausgewählt. Der Film wurde ein unglaublicher Publikumserfolg und sein Protagonist zu einem umjubelten Leinwand-Idol.
"Die Söhne der Großen Bärin", nach dem gleichnamigen Romanbestseller (1962/1963) von Liselotte Welskopf-Henrich , wurde für die DEFA zum Ausgangspunkt einer ganzen Reihe weiterer Indianerfilme. Im Gegensatz zu den Wildwestfilmen von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs thematisierte die DEFA jedoch vorrangig den meist aussichtslosen, aber dennoch heroischen Unabhängigkeitskampf der Indianer und erzählte zumeist authentische Geschichten auf Basis historischer Vorlagen oder Begebenheiten.
Stets verkörperte Mitic den positiven Helden, den edlen, mutigen, ehrlichen, selbstbewussten und selbstlosen Indianerhäuptling. Für Millionen begeisterter Zuschauer war er der vielleicht einzige wirkliche Star der DEFA. Mehrfach spielte Mitic historische Figuren, wie die Indianerhäuptlinge Osceola, Tecumseh und Ulzana. Für die Filme "Apachen" (1973) und "Ulzana" (1974) arbeitete er auch als Co-Autor an den Drehbüchern mit. Bis 1983 verkörperte Mitic in insgesamt 12 Indianerfilmen die Hauptrollen und spielte in unzähligen Kino- und Fernsehfilmen.
Über zehn Millionen Kinobesucher allein in der ehemaligen DDR, Aufführungen in Osteuropa, Asien, Afrika und arabischen Ländern: Gojko Mitic und der DEFA-Indianerfilm schrieben eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Quelle: defahalloffame.de
Volkssolidarität
Die Volkssolidarität ist eine im Oktober 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands gegründete Hilfsorganisation. Sie hatte in der DDR eine wichtige Bedeutung im Sozialbereich. Das Leitmotiv des Verbandes ist Solidarität.

Als Gründungstag der Volkssolidarität gilt der 17. Oktober 1945, an dem der Aufruf "Volkssolidarität gegen Wintersnot!", gemeinsam verfasst von der KPD, SPD, CDU, LDPD sowie der evangelischen und der katholischen Kirche und den Gewerkschaften unterzeichnet wurde, dessen Veröffentlichung in der "Sächsischen Volkszeitung" am 19. Oktober 1945 erfolgte.
Am 20. Mai 1946 wurde dann der "Zentralausschuss der Volkssolidarität" für die sowjetische Besatzungszone gegründet, "der auf breitester demokratischer Basis, nämlich aus Vertretern der Parteien, verschiedener sozialer Ausschüsse, der Kirchen und staatlichen Stellen, zusammengesetzt war". Das Wirken der Volkssolidarität konzentrierte sich in dieser Zeit auf jene, die am schwersten unter den Folgen des Krieges zu leiden hatten. Das waren Kinder, Alte und Kranke, Vertriebene und heimkehrende Kriegsgefangene.
Ab Anfang der 1950er Jahre wandelte sich der Charakter der Volkssolidarität. Ihre vorrangige, später ausschließliche Aufgabe wurde die Betreuung älterer Menschen. Ab 1956 wurde mit der Schaffung von Klubs zur sozial-kulturellen Betreuung Älterer begonnen.
Trabant
Trabant heißt die ab 1957 in der DDR gefertigte Pkw-Baureihe der Hersteller VEB Automobilwerk Zwickau und VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Zwischen November 1957 und April 1991 wurden in Zwickau insgesamt 3.051.385 Fahrzeuge der Trabant-Baureihe produziert. Das Fahrzeug galt als sparsam, preiswert und robust, hatte jedoch gegen Ende der Produktionszeit auf Grund des veralteten Modelldesigns und fehlender Neuerungen seinen Zenith deutlich überschritten.

Im DDR-Sprachgebrauch wurde der Trabant meist Trabi (Trabbi) genannt.
Nach der Übernahme der Auto-Union-Werke in Sachsen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam der Fahrzeugbau in der DDR der 1950er-Jahre nur schleppend voran. Man kämpfte mit Materialknappheit und für Großserien unzureichenden Produktionsstätten. Da zu dieser Zeit in der DDR aber noch das Ziel war, wirtschaftlich mit dem Westen gleichzuziehen - und somit auch die massenhafte Flucht der Ostdeutschen über die noch offene Grenze zu mindern - beschloss das Politbüro 1954, einen neuen, preiswerten und robusten Kleinwagen in Auftrag zu geben.
Als Eckdaten waren ein Gewicht von max. 600 kg und ein Verbrauch von 5,5 l/100 km vorgegeben. Der Preis sollte bei einer Jahresproduktion von 12.000 Stück nicht mehr als 4000 Mark betragen. Außerdem sollte die Außenhaut aus Kunststoff gefertigt sein, da Tiefziehblech auf der Embargoliste der westlichen Länder stand und daher in der DDR relativ rar und teuer war - sowjetisches Tiefziehblech erwies sich als ungeeignet. Die damals durchaus moderne Kunststoffhülle sollte erst später ihre Nachteile aufzeigen. Zum Konstruktionsbeginn überwog noch ihre Wetterfestigkeit und leichte Verfügbarkeit. Erst später sollte man erkennen, wie schwer sie zu entsorgen ist, aber noch mehr, wie diese Kunststoffe der Produktivität im Wege standen. Die langen Aushärtezeiten der Kunststoffe in den teuren Pressen blockierten diese und verhinderten so eine Produktivitätssteigerung. In dem Zeitraum, in dem ein Kunststoffteil entstand, produzierten die Pressen für Metall dutzende Teile.
Gulag
Gulag (russisch) - auch GULag - ist das Akronym für Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und gleichzeitig synonym für ein umfassendes Repressionssystem in der Sowjetunion, bestehend aus Zwangsarbeitslagern, Straflagern, Gefängnissen und Verbannungsorten. Sie dienten der Unterdrückung politischer Gegner, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit, medizinischen Menschenversuchen und der Internierung von Kriegsgefangenen.
Das Lagersystem stellte ein wesentliches Element der stalinschen Herrschaft dar. In der Forschung ist unumstritten, dass die sowjetischen Arbeitslager - im Unterschied zu den deutschen Vernichtungslagern - nicht mit dem Ziel der planmäßigen Ermordung errichtet wurden; die hohen Todeszahlen sind auf die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen zurückzuführen und wurden vom leninschen und in gesteigertem Umfang vom stalinistischen Regime billigend in Kauf genommen. Quelle: Wikipedia
Deutsche Mark
(21. Juni 1948 bis 31. Dezember 2001) Die Deutsche Mark (abgekürzt DM und im internationalen Bankenverkehr DEM, umgangssprachlich auch D-Mark oder kurz Mark, im englischsprachigen Raum meist "Deutschmark") war von 1948 bis 1998 als Buchgeld, bis 2001 nur noch als Bargeld die offizielle Währung in der Bundesrepublik Deutschland und vor deren Gründung in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands und den westlichen Sektoren Berlins.

Sie wurde am 21. Juni 1948 in der Trizone und drei Tage später auch in den drei Westsektoren Berlins durch die Währungsreform 1948 als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und löste die Reichsmark als gesetzliche Währungseinheit ab. Auch nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 blieb die Deutsche Mark die Währungseinheit in der Bundesrepublik einschließlich West-Berlin. Mit Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 1990 löste sie die Mark der DDR ab; die D-Mark blieb auch im wiedervereinigten Deutschland das gesetzliche Zahlungsmittel. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wurde die Deutsche Mark schließlich am 1. Januar 1999 als Buchgeld und am 1. Januar 2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Eine Deutsche Mark war unterteilt in einhundert Pfennig. Die Währung wurde in Münzen und Scheinen ausgegeben. Die Bezeichnung "Deutsche Mark" für die neue Währung der Trizone wurde auf Vorschlag des amerikanischen Offiziers Edward A. Tenenbaum, der als Assistent des Finanzberaters von Militärgouverneur Lucius D. Clay fungierte, auf Konferenzen der Besatzungsmächte einstimmig akzeptiert. Tenenbaum, der einer polnisch-jüdischen Familie entstammte und 1942 in Yale über die deutsche Wirtschaftsgeschichte promoviert hatte, war überdies einer der führenden theoretischen Köpfe und Vorbereiter der Währungsreform von 1948.
ORWO (Abk. für Original Wolfen)
VEB Fotochemische Werke Berlin in Köpenick wirbt 1978 für ORWO-Röntgenfilm

1909 gründete die Agfa AG in Wolfen (jetzt Bitterfeld-Wolfen), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die Filmfabrik Wolfen, die später mit der Marke ORWO (Abk. für Original Wolfen) das Monopol auf die Filmherstellung in der DDR haben sollte.
Neben Filmen für die Fotografie wurden auch Kinofilm für die Filmkunst, Reprografie- und Röntgenfilmmaterial sowie technische Filme und Platten hergestellt. Quelle: Wikipedia
Papiermangel
In der ‚Verlagsgeschichte Akademie Verlag', größter wissenschaftlicher Verlag der DDR, heißt es zu diesem Thema: Politische Einflussnahme und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
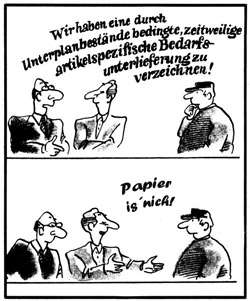
Zwar untersteht der Verlag durch die enge Anbindung an die Akademie nicht der Anleitung und Kontrolle durch das Ministerium für Kultur und seiner Abteilung Literatur und Buchwesen, wie fast alle anderen DDR-Verlage, doch wird allmählich auch im Programm des Akademie-Verlages der Einfluss der Partei sichtbar. In Schriftenreihen, Einzelwerken und auch in einigen Zeitschriften melden sich deren Vertreter zu Wort, legen die Ergebnisse ihrer Arbeit vor und begründen ihre Methode mit marxistisch-leninistischer Begrifflichkeit oder polemisieren gegen "bürgerliche Ideologie", "bürgerliches Denken".
Eine schwierige Situation für die Lektorinnen und Lektoren, die nach verschiedenen Seiten zur Loyalität verpflichtet sind: Müssen sie doch zwischen den politischen und wirtschaftlichen Interessen Kollisionen möglichst vermeiden, und dann noch die Wünsche der mächtigen Akademiemitglieder berücksichtigen. Und über allem schwebte - wenngleich bei wissenschaftlichen Werken nicht extensiv - die vom Staat ausgeübte Zensur.
Einen spürbaren Einschnitt bringt die weltpolitische, vor allem die deutschlandpolitische Entwicklung. Als Folge des zwischen Bundesrepublik und DDR abgeschlossenen Grundlagenvertrages setzt im Osten eine massive Abgrenzungspolitik ein. 1972 wird aus der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin die Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW). Die Akademiereform nach sowjetischem Modell bringt große Zentralinstitute hervor, zugleich aber eine deutliche Verarmung des wissenschaftlichen Lebens und führt auch zur Einstellung von Projekten des Verlages.
Der Argwohn gegenüber "gesamtdeutschen" wissenschaftlichen Vorhaben wächst. Mitunter ist jetzt auf Verlagsseite hartnäckiges und kluges Argumentieren erforderlich, um alteingeführte Vorhaben weiterführen zu können - insbesondere der Hinweis auf Verlust von Devisen und internationaler Reputation, mitunter auch ein wenig List in Form der "Internationalisierung" von Herausgebergremien. Wie der bürokratische Parteiapparat des ganzen Landes, so wachsen mit den Jahren auch die Schwierigkeiten für die Verlage, den Akademie-Verlag nicht ausgenommen. Das Papier ist knapp und zumeist von unzureichender Qualität, die Druckereien sind technisch rückständig und nicht leistungsfähig genug, die Produktionspläne fast immer Makulatur. Quelle: www.oldenbourg-verlag.de
Wladimir Semjonowitsch Wyssozki
(* 25. Januar 1938 in Moskau; † 25. Juli 1980 ebenda) war ein sowjetischer Schauspieler, Dichter und Sänger.
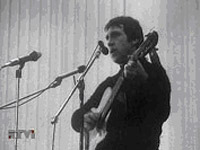
Obwohl seine Platten beim staatseigenen Melodija-Label verlegt wurden, war Wyssozki ein für den sowjetischen Staat äußerst unbequemer Sänger und Dichter. In seinen Liedern sang er auch über Themen, die es offiziell in der Sowjetunion nicht gab: Prostitution, Verbrechen, Antisemitismus. Er ist auch heute noch ein fester Begriff in Russland und gilt dort als der größte Liedermacher des 20. Jahrhunderts.
Da viele seiner Lieder aufgrund ihres kritischen Inhalts von offizieller Seite nicht veröffentlicht wurden, wurden Tonbandmitschnitte seiner Konzerte nach dem Samisdat-Prinzip verbreitet und kursierten millionenfach im ganzen Land. Quelle: Wikipedia
Schellackplatte
Die Schellackplatte ist der Vorläufer der heute noch hergestellten und häufig anzutreffenden Vinylschallplatte.

Schellackplatten hatten meistens einen Durchmesser von 10 Zoll (etwa 25 Zentimeter) oder 12 Zoll (etwa 30 Zentimeter) und überwiegend in Seitenschrift geschriebene Rillen, die mit einem gewöhnlichen Grammophon mit dicker Stahlnadel oder mit einem elektrischen Plattenspieler mit Spezialnadel abgetastet werden konnten. 10-Zoll-Schellackplatten boten maximal etwas mehr als 3 Minuten, 12-Zoll-Schellackplatten etwas mehr als 4 Minuten Spielzeit pro Seite. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Schellackplatte ist die Abspieldrehzahl von 78 min.
Im Oktober 1896 gab der Erfinder und Unternehmer Emil Berliner die Verwendung von Hartgummi als Plattenmaterial auf und ersetzte die Substanz durch eine von der Duranoid Co., Newark, New Jersey, hergestellte Pressmasse, die im Wesentlichen aus Schellack bestand und ursprünglich für Isolatoren entwickelt worden war. Der Schellack band die weiteren Bestandteile Bariumsulfat, Schiefermehl, Ruß und Baumwollflock zu einer verschleißfesten Masse. Die Neuerung verbesserte die Klangqualität und Haltbarkeit der Platten enorm, ein Nachteil war jedoch die hohe Sprödigkeit.
Schellackplatten wurden in der Bundesrepublik Deutschland bis 1958, in anderen Ländern Europas bis in die frühen und in der sogenannten Dritten Welt noch bis in die späten 1960er Jahre hergestellt. Quelle: Wikipedia
México lindo y querido
Ein traditionelles Mariachi-Stück, von Chucho Monge komponiert und durch den Sänger Jorge Negrete berühmt geworden, Patriotismus und die Liebe zum ländlichen Mexiko wird zum Ausdruck gebracht, so in den prägnanten Zeilen
México lindo y querido
Si muero lejos de ti
Que digan que estoy dormido
Y que me traigan aquí
Schönes, geliebtes Mexiko,
Wenn ich fern
von deiner Erde
sterben sollte,
dann sag, dass ich nur schlafe,
und bring mich zu dir zurück.
Volksbuchhandlung
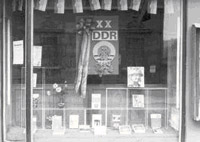
Volkseigene, d.h. staatliche Buchhandlung. Die Volksbuchhandlungen besaßen eine monopolartige Stellung, da die staatliche Gewerbepolitik die Neuzulassung genossenschaftlicher und privater Buchhandlungen aus ideologischen Gründen nicht mehr gestattete, so dass aus Altersgründen die Zahl der privaten Buchhändler stetig abnahm. (Quelle: Birgit Wolf, Sprache in der DDR. Ein Wörterbuch. De Gruyter 2000.)
Konsum (Handelskette)

Konsum war Marke der Konsumgenossenschaften in der DDR. Die einzelne Genossenschaft betrieb Lebensmittelgeschäfte, Produktionsbetriebe und Gaststätten.
Konsum-Logo in der DDR: Ein Fabrikschornstein und eine Sichel formen ein K. Quelle: Wikipedia
Tschaika
Der Tschaika (russisch für Möwe) ist eine Luxuslimousine des Herstellers Gorkowski Awtomobilny Sawod (auf deutsch: Gorkier Automobilwerk), die von 1959 bis 1988 in zwei Modellen und verschiedenen Varianten in der UdSSR gebaut wurde.

Das erste Modell wurde 1959 eingeführt. Er orientierte sich stark am amerikanischen Packard Patrician des Modelljahrgangs 1955. Die modernisierte Version wurde ab 1977 gebaut. Er hatte eine neue, dem Geschmack der 70er Jahre entsprechende Karosserie, basierte technisch aber auf dem Vorgängermodell.

- Gesamtproduktion: 3179 Stück
- Karosserien: 4-türige Limousine mit 7 Sitzplätzen, 2- oder 4-türiges Cabrio, 5-türige Kombiversion
- Motor: 195 PS, 8 Zylinder V-Motor, 5,5 Liter Hubraum
- Getriebe: 3-Gang mit hydraulischem Drehmomentwandler
- Gewicht: 2.100 kg
- Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h
- Kraftstoffverbrauch: ca. 21 Liter/100km
Der Tschaika war ein reiner Funktionärswagen, der nur für hohe Funktionsträger der Sowjetunion und der verbündeten Staaten geliefert wurde. Ein Verkauf an Privatpersonen erfolgte nicht. Quelle: www. wikipedia.de
Marke
Eine Lebensmittelmarke ist ein vom Staat ausgegebenes Dokument zur Bescheinigung, dass der Besitzer ein bestimmtes Lebensmittel in einer bestimmten Menge erhalten darf.
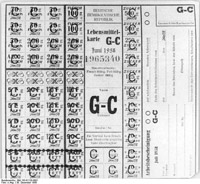
Lebensmittelmarken werden in der Regel in Notzeiten, vor allem im Krieg, an die Bevölkerung ausgegeben, um den allgemeinen Mangel an Konsumgütern besser verwalten zu können. Die Marken sind in Lebensmittelkarten zusammengefasst. Außer Lebensmitteln werden häufig auch andere Konsumgüter, z. B. Heizmaterial (Kohlen), Kleidung, Genussmittel wie Zigaretten und Alkohol sowie Benzin rationiert. Die Erlaubnisscheine heißen dann gewöhnlich Bezugsscheine. Für die Erteilung eines Bezugsscheins musste ein besonderer Anlass - wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes - vorliegen oder ein Antrag gestellt werden.
In der DDR wurde die Lebensmittelkarte bis Mai 1958 benutzt. Ihre Abschaffung hatte eine Veränderung im Preis- und Steuersystem zur Folge, die für alle nicht abhängig Tätigen eine Verschlechterung bedeutete, denn sie war zugleich eine Subventionierung gewesen. Kartoffel- und Kohlekarten wurden erst 1966 abgeschafft. Bis Ende der sechziger Jahre bekam man knappe Lebensmittel wie Butter, Eier und Fleisch nur an seinem Wohnort gegen Vorzeigen eines geschäftsgebundenen Kundenausweises. Bei Urlaub oder auswärtigen Aufenthalten war eine Ummeldebescheinigung des heimischen Händlers vorzulegen.
In Ost-Berlin musste vor Errichtung der Mauer grundsätzlich bei Einkäufen oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die nicht der Rationierung unterlagen, der Personalausweis vorgelegt werden, andernfalls wurde Westgeld verlangt. Quelle: www.wikipedia.de
Eskimo-Eis
Diese in der Sowjetunion sehr beliebte Eismarke kommt in einem überaus populären Zeichentrickfilm für Kinder "" = Tscheburaschka mit dem Krokodil Gena vor, wie in dem hier abgedruckten Text deutlich wird. Das Lied wird zum Geburtstag bis heute von jedermann gesungen!
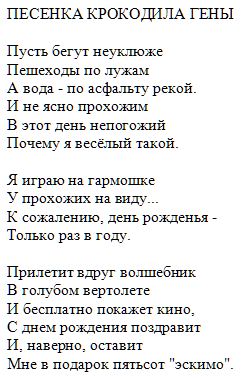
DAS LIED DES KROKODILS GENA
Sollen doch die Fußgänger plump
durch die Pfützen laufen,
und das Wasser auf dem Asphalt
wird zum Fluss.
Und den Vorübergehenden ist
nicht klar,
warum ich an einem solchen
Schlechtwettertag so fröhlich bin.
Ich spiele auf der Ziehharmonika
vor den Augen der Vorübergehenden...
leider ist Geburtstag
nur ein Mal im Jahr.
Es kommt plötzlich ein Zauberer
in einem blauen Hubschauber angeflogen
und er zeigt kostenlos Filme (Kino)
Gratuliert zum Geburtstag
und gibt mir als Geschenk
500 Eskimo-Eis.
Prostokwascha
Bei ‚Prostokwascha' handelt es sich um eines der vielen für die russische Küche so typischen Sauermilchprodukte: ursprünglich wohl ukrainischen Ursprungs, lässt es sich am ehesten mit einem Joghurt oder einer dicken Buttermilch vergleichen.
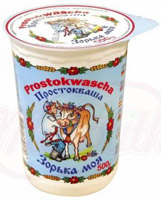
Metro
Die Moskauer Metro (russisch Moskowskij metropoliten, umgangssprachlich Moskowskoje metro), 1935 eröffnet, ist die U-Bahn der russischen Hauptstadt Moskau. Sie gehört zu den U-Bahn-Systemen mit den tiefsten Tunneln und Bahnhöfen der Welt, verfügt über ein 305,5 Kilometer langes Liniennetz mit 185 Stationen. und ist mit knapp 2,4 Milliarden Fahrgästen jährlich (Stand: 2009) auch eine der am stärksten in Anspruch genommenen U-Bahnen der Welt. Außerdem sind die Stationen der Moskauer Metro aufgrund ihrer teilweise sehr anspruchsvollen Architektur als unterirdische Paläste bekannt.

Zahlreiche Stationen sind aufgrund ihrer Prägung durch den sozialistischen Klassizismus zu Zeiten Stalins sehr prunkvoll ausgestattet. Einige dieser Bahnhöfe sind sehr detailreich und werden in diversen Reiseführern als besonders sehenswert eingestuft.

Da viele Stationen sehr tief liegen, wurden lange, besonders schnell fahrende Rolltreppen installiert. Die Station Park Pobedy (Linie 3) liegt 84 Meter unter der Oberfläche und verfügt nach Angaben der Metro über die weltweit längsten Rolltreppen (126 m, 740 Stufen). In manchen Stationen dauert es bis zu drei Minuten, bis man Oberflächen- bzw. Bahnsteigniveau erreicht. Seit dem Bau der Metro 1935 war vorgesehen, das Metrosystem auch als Luftschutzbunker zu nutzen, was die große Bautiefe erklärt. (nach Wikipedia)
Samowar
Ein Samowar (‚samo' - "selbst"; ‚war' - "kocht"; wörtlich übersetzt "Selbstkocher") ist eine ursprünglich russische Teemaschine bzw. Wasserkocher. Samoware sind meist recht groß und oft kunstvoll verziert. Erste schriftliche Erwähnungen des Samowars finden sich in den 1730er Jahren.
Der klassische russische Samowar wird vorwiegend in der Stadt Tula hergestellt. Wenn man etwas Überflüssiges tut, trägt man in Russland keineEulen nach Athen, sondern fährt mit dem eigenen Samowar nach Tula.

Familienporträt in Russland (1844) mit dem Samowar Den größten Teil eines Samowares stellt der metallene, meist kupferne Wasserkessel dar, an dessen unteren seitlichen Rand sich ein Ablasshahn befindet, unter den man ein Teeglas zum Befüllen stellen kann. Ursprünglich wurde ein Samowar mit Holzkohle oder Petroleum beheizt, modernere Modelle funktionieren jedoch meist mit elektrischen Heizelementen ähnlich derer heutiger Wasserkocher.
Die mit Brennstoffen beheizten Samoware haben im Inneren des Wasserkessels eine Röhre, in welcher die Verbrennung erfolgt. Die Zufuhr der Verbrennungsluft erfolgt über eine Lochblende unter dem Kessel. Über die Rohrwandung wird die Wärme an das die Röhre umgebende Wasser abgegeben. Gleichzeitig sorgt die senkrechte Röhre für den für eine gute Verbrennung nötigen Kamineffekt. Das obere Ende der Röhre durchstößt den Deckel des Wasserkessels mittig von unten. Zum Anheizen des Samowars wird auf das obere Rohrende eine Verlängerung aufgesetzt, um den Kamineffekt noch zu erhöhen. Ist das Wasser fertig gekocht, wird die Rohrverlängerung durch den sogenannten "Komfort" ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufsatz, der an seiner Seite kleine Öffnungen hat, aus denen die noch heiße Verbrennungsluft (oberhalb des Kesseldeckels) austreten kann. Darauf kann eine kleine separate Kanne gesetzt werden, in der dann der eigentliche Tee zubereitet wird. Bei grusinischem Tee ist der Gehalt an Tannin, den Gerbstoffen, wesentlich niedriger als bei asiatischen Teesorten, der Sud kann also auf den Blättern stehen bleiben.
Genaugenommen wird in dieser Kanne jedoch kein servierfertiger Tee zubereitet, sondern es wird mit einer großen Menge an Teeblättern und wenig Wasser ein Teekonzentrat hergestellt. Den trinkbaren Tee erhält man erst, indem man eine kleine Menge Teekonzentrat mit dem kochenden Wasser aus dem Samowar verdünnt, in etwa im Verhältnis von 1:3 bis 1:10. Das heiße Teeglas kann dann in einem metallenen Halter, dem Podstakannik, gefahrlos in der Hand gehalten werden.
Quelle: www.wikipedia.de und www.regina-karolyi.de/samowar.html
Brot

Die historische Herleitung dieser staatlichen Subventionierung von Grundnahrungsmitteln lässt sich nachlesen auf der internet-Seite docupedia.de unter dem Stichwort "Sowjetische Geschichte". Dort heißt es über die Veränderungen, die mit der Periode der Entstalinisierung eintraten:
"In erster Linie ist dies der Ausbau des Sowjetsystems zu einem Sozialstaat, wenngleich auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Diese Entwicklung setzte erst mit der Sozialgesetzgebung von 1956 ein und verstärkte sich in den ersten zehn Jahren der Brežnev-Periode 1964/65-75. Die "Sozialpolitik", für die sowjetische Ideologen früher nur Hohn übrig hatten, da sie sie für sozialdemokratische Reparaturarbeiten am Kapitalismus erachteten, entstand nicht allein aus Gründen des nun entstalinisierenden Wohlwollens der Regierung. Seit Stalins Tod war es immer wieder zu vernehmlichem Murren in der Bevölkerung gekommen, die den Lohn ihrer Entbehrungen einforderte.
So verband sich das Eingehen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, die Steigerung der sozialen Leistungen, das erhöhte Konsumniveau, die verbesserte medizinische Versorgung, der boomende Wohnungsbau, der sich ausweitende Ausbildungssektor, die Subvention der Grundnahrungsmittel und auch die verfassungsmäßig garantierte Vollbeschäftigung zu einer gigantisch teuren Sozialpolitik, mit deren Hilfe das Regime versuchte, Loyalität bei der Bevölkerung zu erkaufen. Dieses Konglomerat politisch-sozialer Beziehungen zwischen Bevölkerung und Regime ist als sowjetischer "welfare-state authoritarianism" bezeichnet worden."
Noch 1991 berichtete der SPIEGEL aus dem Dorf Fjodorowka über den subventionierten Brotpreis in Russland:
"… Kapusta ißt man mit viel Brot. Die Iwanows haben genügend davon im Haus. Der Küchentisch und die Heizkörper in der Küche und im Wohnzimmer sind mit dicken Graubrotscheiben belegt.
Mit dem getrockneten Brot im Küchenschrank macht das zusammen etwa einen Sechs-Wochen-Vorrat. Trockenbrot kann man monatelang lagern, ohne daß es schimmelt.
Die Leute in Fjodorowka haben reichlich Brotvorräte angelegt. Wenn sie es selbst nicht brauchen, was wahrscheinlich ist, verfüttern sie es eben an die Hühner. Brot ist hoch subventioniert in der Sowjetunion und deshalb billiger als Hühnerfutter. …"
Quelle: DER SPIEGEL 6/1991
Wahl in der DDR

Ganz eindeutig konstatiert die Internet-Seite www.wahlrecht.de/lexikon/ddr: es bestand keine Wahlpflicht, aber es wurde ein starker gesellschaftlicher Druck ausgeübt.
Anlässlich einer Debatte über eine mögliche Wahlpflicht angesichts sehr niedriger Wahlbeteiligung befand ein Diskussionsteilnehmer:
"Der Wähler ist ein mündiges Wesen. Er hält sich nicht an Meinungsumfragen, er straft Politiker ab, mit denen er unzufrieden ist, er belohnt gute Arbeit - und er bleibt zu Hause, wenn er meint, mit seinem Kreuz keine Wirkung zu erzielen. Denn er ist ein freier Bürger, der sein Wahlrecht nutzt und sich von den Fesseln der Pflicht befreit hat. Das gilt übrigens besonders für die Ostdeutschen, die zwar auch in der DDR keine Wahlpflicht kannten, aber unter einem starken gesellschaftlichen Druck standen, die Einheitslisten zu bestätigen. So erreichte man 99,73 Prozent Wahlbeteiligung zur Volkskammerwahl 1986." (Kölner Stadt-Anzeiger, 28.3.2006)
Auf der Internet-Seite einer Schule in Braunschweig wird von einer Veranstaltung mit Joachim Gauck berichtet, der vor einem Publikum von 6000 Schülern sich über die Lebensverhältnisse in der DDR äußert:
"Joachim Gauck berichtete auch darüber, wie es war, wenn man in der DDR von seinem Wahlrecht Gebrauch machen wollte. Man nannte das Wählen auch "Falten gehen", weil man lediglich den Stimmzettel mit den Namen der Kandidaten vor aller Augen zusammenfalten und in die Wahlurne stecken musste. War man mit der Liste der Nationalen Front nicht einverstanden, so konnte man in die Wahlkabine am Ende des Raumes gehen, zog allerdings alle Blicke auf sich und wurde von allen Leuten angestarrt.
Wenn man nicht Wählen ging, standen stündlich Leute vor der Tür, die einen darauf hinwiesen, dass man noch nicht gewählt habe und dass man es noch tun müsse. Man wurde also zum "Faltengehen" gezwungen."
Quelle: www.masch-news.de
Und auf www.politik-digital.de findet sich unter dem Stichwort "Die Mauer im Mund" eine Sammlung von ostdeutschen Begriffen, die im Laufe der Zeit weitgehend in Vergessenheit gerieten. Zum Thema ‚Politik und Gesellschaft' werden genannt: "Winkelemente Papierfähnchen bei offiziellen Veranstaltungen Bonbon Parteiabzeichen der SED Horch und Guck Stasi Falten gehen wählen gehen DSF Deutsch-Sowjetische Freundschaft Kaderabteilung Personalabteilung Aluminium Mark DDR-Geld Fehlersitzung Krisenrat Subbotnik freiwilliger, unbezahlter Arbeitseinsatz TGL DIN-Norm des Ostens."
Letscho

Letscho (ungarisch Lecsó, tschechisch und slowakisch Leco, polnisch Leczo) ist ein einfaches Schmorgericht der ungarischen Küche aus Gemüsepaprika, Tomaten und Zwiebeln, das früher in der DDR beliebt war und sich weiterhin in Ostdeutschland großer Beliebtheit erfreut.
Das Gericht ist sehr beliebt als Beilage zu Grillgerichten, Bratwurst und anderen Fleischgerichten. In Ostdeutschland bieten Supermärkte und Lebensmittelläden verschiedene Sorten Letscho im Glas an. Verwandte Gerichte sind Ajvar und die italienische Peperonata, die jedoch milder gewürzt und kürzer gegart ist. Die hier vorgestellte Variante ist mit Speck zubereitet; dieser kann auch weggelassen werden, oder man kann Weiß- oder Rotwein hinzufügen.
|
Zutaten
|
Zubereitung
|
Ikarus

Ikarus ist ein ungarischer Hersteller von Omnibussen und Oberleitungsbussen in Budapest-Mátyásföld und Székesfehérvár.
Das Unternehmen Ikarus wurde 1895 gegründet und war hauptsächlich für seine Reisebusse und Stadtbusse bekannt, die in der Ostblock-Zeit eine bedeutende Rolle spielten. Vor allem die Busse der 200er Serie wurden in enormen Stückzahlen produziert und führten dazu, dass Ikarus mit einer Jahresproduktion von 15.000 Bussen zeitweilig der größte Omnibushersteller der Welt war.

Über 30.000 Busse wurden allein in die DDR geliefert, die letzten im Jahre 1990. In vielen Nachfolgestaaten der UdSSR werden noch heute Ikarus-Busse eingesetzt. Zu Zeiten des Ostblocks wurden Ikarus-Busse auch in Kuba, Mozambique, Angola und im Iran aus CKD-Kits zusammengesetzt. Quellen: Wikipedia
im neuen Staat - Gründung der DDR

In der sowjetisch besetzten Zone stellte die Besatzungsmacht früh die Weichen für eine eigenstaatliche sozialistische Entwicklung. Die deutschen Kommunisten witterten ihre Chance, im Schutz der Roten Armee ihre Vision einer neuen demokratisch-sozialistischen Ordnung zu verwirklichen.
Walter Ulbricht war nach Kriegsende aus Moskau als Leiter der KP-Gruppe Berlin zurückgekehrt. 1945 verkündete er, eines der wichtigsten politischen Ziele sei "der Kampf gegen die faschistische Ideologie und andere reaktionäre Ideologien, die gegen das Interesse der Arbeiterklasse, die gegen eine fortschrittliche Entwicklung in Deutschland gerichtet ist."
Mit der SED, die im April 1946 aus der Zwangsvereinigung von KPD und SPD hervorging, entstand das wichtigste Instrument, mit dem die sowjetischen Besatzer ihre gesellschaftlichen und ideologischen Vorstellungen umsetzten. Unter der Führung eines Politbüros mit Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht an der Spitze, entwickelte sich die SED zu einer marxistisch-leninistischen Partei, die sich mit Hilfe der Besatzungsmacht gegenüber den anderen Parteien eine Vorrangstellung sicherte.
Partei-Funktionäre wie Walter Ulbricht begründeten die Führungsrolle der SED freilich anders: "Die sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird zur führenden Partei in ganz Deutschland werden, weil der Tag kommen wird, an dem die große Mehrheit der Deutschen es so will."
Tatkräftige Unterstützung erhielt die SED von der Freien Deutschen Jugend, der FDJ. Die Einheitsjugendorganisation war 1946 aus einem von Erich Honecker gegründeten Jugendausschuss für die Ostzone hervorgegangen. Die FDJ wurde rasch zu einer der SED treu ergebenen Massenorganisation, die beim Aufbau eines sozialistischen Staates mitwirkte.
Mit der Volkskongressbewegung schuf sich die SED ab 1947 ein Forum, um sich als Partei der nationalen Verantwortung und als Garant der Einheit Deutschlands in Szene zu setzen. Ende 1948 reisten Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Otto Grotewohl nach Moskau. Dort erhielten sie die Zustimmung Stalins zu einer Staatsgründung in der sowjetisch besetzten Zone.

Als die Kommunisten von Stalin grünes Licht erhielten, hatten sie mit den Vorbereitungen für die Staatsgründung längst begonnen. Bei den Wahlen zum Deutschen Volkskongress im März 1948 wurde ein Verfassungsausschuss unter der Leitung Otto Grotewohls gebildet. Dieser erarbeitete den Entwurf einer Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, der vom Volkskongress im Mai 1949 angenommen wurde. Mit manipulierten Einheitslisten hatte sich die SED die Kontrolle über den Kongress gesichert. Dieser wählte den Deutschen Volksrat, der sich am 7. Oktober als provisorische Volkskammer der DDR konstituierte. Otto Grotewohl wurde mit der Bildung einer Regierung beauftragt.
Am 7. Oktober 1949 wurde aus der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Bereits im Mai war die Bundesrepublik gegründet worden.
Vorher wurden in mehreren Stufen die Voraussetzungen für die Staatsgründung der DDR geschaffen:
Im Dezember 1947 entsteht in der SBZ die "Volkskongressbewegung für Einheit und gerechten Frieden" unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Aus ihr geht im März 1948 der 1. Deutsche Volksrat hervor, dessen Teilnehmer teilweise aus den Westzonen kommen. Der Volksrat veranlasst ein Volksbegehren zur deutschen Einheit und setzt einen Verfassungsausschuss unter Leitung von Otto Grotewohl ein. Dessen Entwurf für eine "Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik" wird am 19. März 1949 vom Volksrat formell beschlossen.

Die Wahlen zum III. Deutschen Volkskongress im Mai 1949 erfolgen aufgrund von Einheitslisten. Die Mandate werden schon im voraus zwischen den Parteien und Massenorganisationen der DDR aufgeteilt. Der Protest der Bevölkerung zeigt sich in 31,5 Prozent Nein-Stimmen und 6,7 Prozent ungültigen Stimmen. Die 1400 Delegierten des III. Deutschen Volkskongresses nehmen den Verfassungsentwurf an und wählen aus ihren Reihen den 2. Deutschen Volksrat.
"Auf der Grundlage der vom 3. Deutschen Volkskongress bestätigten Verfassung ist in der deutschen Hauptstadt Berlin einmütig von allen Parteien und Massenorganisationen im deutschen Volksrat die Deutsche Demokratische Republik geschaffen worden." So verkündete Wilhelm Pieck am 7. Oktober 1949 im großen Festsaal des früheren Reichsluftfahrtministeriums das Ereignis. Allerdings war die Entscheidung im Volksrat tatsächlich zwar einmütig gewesen, doch wurde das Gremium dominiert von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED.
Der 7. Oktober war der Endpunkt einer Entwicklung, die schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs begonnen hatte.
Unter Führung von Wilhelm Pieck tritt der Volksrat am 7. Oktober 1949 in Ost-Berlin zusammen. Er erklärt sich zur Provisorischen Volkskammer der DDR und beauftragt Otto Grotewohl mit der Regierungsbildung. Zum ersten Präsidenten der DDR wird Wilhelm Pieck gewählt. Damit ist als zweiter deutscher Staat die Deutsche Demokratische Republik gegründet.
Schon einen Monat später erhält der neue Staat auf Veranlassung des Zentralkomitees der SED auch eine eigene Hymne, in der das Ziel der Einheit Deutschlands besungen wurde, denn anfangs betrachtete die SED den neu gegründeten Staat als Provisorium. Doch ab den 1970er Jahren führte man sie nur noch in der Instrumentalfassung auf. Das Thema Einheit war abgehakt. Quellen: www.einestages.spiegel.de; www.hdg.de (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland); www.ingeb.org/Lieder/aufersta.html; ww.wikipedia.de
|
1. Strophe |
2. Strophe |
3. Strophe |
8. März, Frauentag
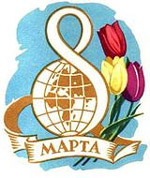
Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines internationalen Frauentages vor, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu favorisieren. Die Idee dazu kam aus den USA. Dort hatten Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas (SPA) 1908 ein Nationales Frauenkomitee gegründet, welches beschloss, einen besonderen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht zu initiieren.
Am 8. März 1917 - nach russischem (julianischem) Kalender der 23. Februar - streikten in Sankt Petersburg die Arbeiter- und Soldatenfrauen und erstmals auch Bauernfrauen der armen Stadtviertel auf der Wyborger Seite und lösten damit die Februarrevolution aus. Zu Ehren der Rolle der Frauen in der Revolution wurde auf der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau auf Vorschlag der bulgarischen Delegation der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt.
Nach anderer Darstellung war es nach Aufforderung von Alexandra Kollontaj und anderen Vorkämpferinnen Lenin, der in diesem Jahr, 1921, den 8. März zum "Internationalen Frauentag" erklärte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im geteilten Deutschland sehr unterschiedlich mit dem Frauentag umgegangen. 1946 führte die sowjetische Besatzungszone den 8. März wieder ein. In der DDR war der Frauentag durch seine Geschichte geprägt, er hatte zunächst den Charakter einer sozialistischen Veranstaltung und wurde erst in den späten 1980ern festlicher, ungezwungener und weniger ideologisch begangen.
Erst mit dem Engagement der neuen Frauenbewegung Ende der 1960er Jahre rückte der 8. März in der Bundesrepublik und anderen Ländern wieder stärker ins Bewusstsein, allerdings hatte es die autonome Frauenbewegung in der BRD sehr schwer mit diesem Tag. So war noch 1977 in der feministischen Zeitung Courage zu lesen: "Nichts gegen einen Feiertag, auch nicht gegen einen Frauentag. Nur muß er von denen, die gefeiert werden, bestimmt und gestaltet werden." Diese Kritik richtete sich vor allem gegen die Feierpraxis in der DDR, wo dieser Tag zunehmend zu einer Art 'sozialistischer Muttertag' geworden war.
Quelle: www.wikipedia.de
Gleichberechtigung von Mann und Frau in der DDR

Um die ökonomische Leistungsfähigkeit der DDR zu sichern, richtete sich im Rahmen der formal-juristischen Gleichstellung von Frauen, das Hauptaugenmerk der Gesetzgebung zunächst einmal auf frauenspezifische Schutzrechte und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, um die Berufstätigkeit von Frauen zu fördern. Im Weiteren sollten Regelungen und familienpolitische Bestimmungen folgen, die angesichts des Geburtenrückganges in der DDR, die Verbindung von Mutterschaft und Berufstätigkeit für Frauen ermöglichen sollten, um den gesellschaftlichen Fortbestand der DDR zu sichern. Die Mischung ökonomischer und bevölkerungspolitischer Ziele fand dabei ihre ideelle Entsprechung im Leitbild der "werktätigen Frau und Mutter".
Auf Grund der Kriegstoten und Gefangennahmen in Folge des 2. Weltkrieges bestand in der damaligen SBZ im Jahr 1945 ein demografischer Frauenüberschuss von 57,5 %. In der Zeitspanne von 1945 bis 1949 war es daher insbesondere erforderlich, Frauen zum Wiederaufbau und zur Produktion zu bewegen und rechtliche Voraussetzungen für die Gleichberechtigung der Geschlechter im Erwerbssektor zu schaffen. Der Gleichheitsgrundsatz der DDR-Verfassung schuf schließlich die Grundlage für die nahezu uneingeschränkte Einbeziehung der Frauen in den Erwerbssektor und deren berufliche Qualifikation. So heißt es in der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1949:
Artikel 7:"Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen sind aufgehoben."
Artikel 18 "… Mann und Frau … haben bei gleicher Arbeit das Recht auf gleichen Lohn. Die Frau genießt besonderen Schutz im Arbeitsverhältnis. Durch Gesetz der Republik werden Einrichtungen geschaffen, die es gewährleisten, daß die Frau ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann …."
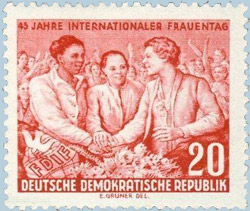
Durch den Mangel an männlichen Arbeitskräften, fehlten in der Nachkriegszeit insbesondere Facharbeiter und Arbeitskräfte für schwere körperliche Arbeiten. Zudem waren "weiblich" dominierte Arbeitsplätze etwa in der Verwaltung oder der Textilindustrie nach 1945 stark dezimiert worden, so dass Frauen zunehmend in typisch "männlichen" Berufszweigen eingesetzt wurden. Hierzu war es notwendig, den traditionellen Vorstellungen und Vorurteilen bezüglich der Berufstätigkeit von Frauen entgegenzuwirken und Frauen entsprechend zu qualifizieren.
Von 1949 bis 1957 stieg der Frauenanteil im Erwerbsleben wiederum an, wenngleich der Frauenanteil an der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter auf Grund der ersten großen Fluchtwelle seit der Gründung der DDR und der Rückkehr von Männern aus der Kriegsgefangenschaft, gesunken war. In dieser Phase des Beginns der Planwirtschaft (erster Fünfjahresplan 1951-1955) ging es in erster Linie um den Wiederaufbau der Industrie und somit um den gelenkten Einsatz von Frauen in wirtschaftlich relevante Zweige wie Bauwesen, Elektroindustrie, Feinmechanik und Maschinenbau.
Neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurde auch auf "moralischer" Ebene an das Verantwortungsbewusstsein der Frauen appelliert. Die Berufstätigkeit wurde dabei als inneres Bedürfnis aller Menschen und als immanenter Bestandteil der Persönlichkeitsentfaltung dargestellt. Zudem wurde in dieser Zeit insbesondere am ideologischen Unterbau für die Berufstätigkeit der Frauen gearbeitet, und die Erwerbsbeteiligung zum alleinigen Maßstab der Gleichberechtigung der Geschlechter erklärt. Praktisch gesehen erschwerten den Frauen insbesondere die fehlenden bzw. mangelhaften Kinderbetreuungseinrichtungen, die Verbindung von Familie und Berufstätigkeit. Die wichtigste Neuerung im Bereich der Gesetzgebung zur Frauen- und Familienpolitik in dieser Zeit war 1950 die Verabschiedung des Gesetzes über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau.
Quelle: www.wikipedia.de
Königin der Nacht

Ihren Namen bekam die Pflanze, die botanisch korrekt Selenicereus grandiflorus heißt - wegen ihrer großen weiß bis cremeweißen Blüten, die nur für eine einzige Nacht blühen.
Übersetzt bedeutet der Name so viel wie "großblumiger Mondkaktus" - und das trifft die Sache im Kern. Wer schon einmal das faszinierende Schauspiel erlebt hat, wenn sich über Stunden die großen Knospen öffnen, weiß, dass die Pflanze ihren majestätischen Titel sehr zu recht trägt. Bis in die frühen Morgenstunden läßt sich das Aufblühen und Vergehen erleben. Spätestens am Vormittag ist die Blüte nur noch ein Schatten ihres Selbst. Unabhängig davon, ob sie bestäubt wurde oder nicht, schließt sich die Blüte wieder und sinkt nach unten.
Es handelt sich um einen Schlangenkaktus, beheimatet auf den Antillen, der bis zu 5 Meter lange, sich windende Stängel von 3 - 5 cm Durchmesser hat. Das Verbreitungsgebiet der Art erstreckt sich von den Karibischen Inseln Jamaika, Kuba und Hispaniola bis zum östlichen Flachland Mexikos. Es dauert drei bis fünf Jahre, bis die Pflanzen blühen.
Quelle: www.cactusblog.de
Die Blüte in diesem Film beginnt nach ca. 37 Sekunden.
Politische Exilanten in Mexiko nach 1933
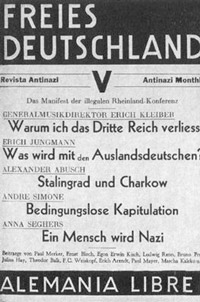
Politische Exilanten in Mexiko nach 1933 Neben den Auslandsdeutschen und den jüdischen Emigranten, die ihre Gegensätze nicht überbrücken konnten, fand sich mit den politischen Exilanten aus Deutschland und Österreich eine dritte, überaus aktive Gruppe in Mexiko ein. So restriktiv sich das Land gegenüber der jüdischen Massenflucht aus Europa verhielt, so großzügig gewährten seine Behörden exponierten politischen Gegnern des Faschismus Asyl, zumal solchen, die sich für die von Mexiko offiziell unterstützte spanische Republik eingesetzt hatten.
1939 wollte das Land 1500 Kämpfer der Internationalen Brigaden aufnehmen, was jedoch nicht verwirklicht werden konnte. Diese Grundeinstellung machte Mexiko aber zum begehrten Fluchtpunkt vor allem für jene Exilanten, denen in französischer Internierung die Auslieferung an Hitlerdeutschland drohte.
Bis Mitte 1942 hatte sich mit Schriftstellern und Parteifunktionären das wichtigste Zentrum der KPD-Emigration im westlichen Exil der Kriegsjahre gebildet. Das Land wurde nach Kriegsbeginn zum Zufluchtsort der linksstehenden Exilanten aller Schattierungen, denen aufgrund ihrer politischen Orientierungen der Weg in die USA und andere überseeische Asylländer versperrt geblieben war.
Innerhalb der in Mexiko erscheinenden deutschsprachigen Presse sticht einmal die ab 1941 erscheinende Zeitschrift "Freies Deutschland" hervor, die als "brilliant redigierte politisch-kulturelle Monatszeitschrift" angesehen wird, die bei internationaler Verbreitung in einer Auflage von bis zu 4.000 Exemplaren kontinuierlich bis Mitte 1946 erschien.

Die im Roman eine wichtige Rolle spielende Zeitung "Demokratische Post" hat tatsächlich existiert: seit August 1943 erschien dieses zweiwöchentlich herausgegebene Lokalblatt. Besondere Bedeutung kommt der deutschen Exilliteratur in Mexiko zu. Eine herausragende Stellung nahm der im November 1941 gegründete Heinrich Heine-Klub ein, präsidiert von Anna Seghers. Der Heine-Klub wurde zum anerkannten, multinationalen kulturellen Zentrum einer kleinen, personell überschaubaren Gemeinde deutschsprachiger Exilierter und Emigranten, in dem Angehörigen künstlerischer und akademischer Berufe ein Betätigungsfeld geboten wurde. Bis zum Frühjahr 1946 veranstaltete der Klub regelmäßig literarische Abende, Theateraufführungen, Filmveranstaltungen, Konzerte und wissenschaftliche Vorträge. Das Veranstaltungsangebot zeichnete sich durch ein ausgesprochen hohes Niveau aus.
Zu den besonderen Leistungen der kommunistischen Exilanten in Mexiko gehört schließlich der Exilverlag El Libro Libre. Anfang 1943 erschien hier Anna Seghers' berühmter Roman "Das siebte Kreuz". Auch Kisch, Feuchtwanger und Heinrich Mann waren Autoren dieses Verlags. Charlottes Beschäftigung mit aztekischer Kunst für einen Zeitungsbeitrag hat als realen Bezug die bahnbrechende Arbeit des Exilanten Paul Westheim. Er ist der Begründer einer Ästhetik der präcortesianischen Sakralkunst, 1950 erschien seine Studie Arte Antiguo de México (Die Kunst Alt-Mexikos, 1966). Sie wurde zum Klassiker, zahlreiche weitere Bücher folgten.
Interessant ist natürlich auch die literarische Auseinandersetzung mit dem Gastland, die zum Teil erst nach der Rückkehr in die Heimat erschien. In Ruges Roman kommt das in der Episode zum Tragen, in der Charlotte 1961 für das ND eine Veröffentlichung eines westdeutschen Autors in einem DDR-Verlag rezensiert und zu einem Verriss gestaltet, was von ihrem Sohn Kurt so ausgelegt wird, dass sie sich in politische Richtungskämpfe einspannen lässt. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, die reale Vorlage für diese Darstellung zu entschlüsseln. Meine entsprechende Anfrage beim Lektorat des Rowohlt-Verlags blieb unbeantwortet. (Quelle: Auswertung des Artikels von Fritz Pohle, "Die ‚Revolutionäre' treffen ein. Deutschsprachige in Mexiko (Teil 2): Politische Exilanten nach 1933", aus: Matices - Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien und Portugal, siehe: www.matices.de/18/18ppohle.htm; dhm.de; anna-seghers.de)
KOMmunistische INTERNationale

Die Kommunistische Internationale (kurz Komintern oder KI), auch Dritte Internationale genannt, war ein internationaler Zusammenschluss kommunistischer Parteien zu einer weltweiten gemeinsamen Organisation. Die Gründung erfolgte 1919 in Moskau auf Initiative Lenins, der die Zweite Internationale mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 für tot erklärt hatte. Während des Zweiten Weltkrieges löste Stalin 1943 die Kommunistische Internationale als Zugeständnis an seine westlichen Alliierten in der Antihitlerkoalition - die USA und Großbritannien - überraschend auf.
Ab Mitte der 1920er Jahre wurde die Komintern im Zuge der sogenannten Bolschewisierung der kommunistischen Parteien weitgehend von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion dominiert und diente als Einflussinstrument auf kommunistische Parteien und Organisationen in anderen Ländern. Die bedeutendste Sektion außerhalb der Sowjetunion bildete dabei die Kommunistische Partei Deutschlands.
Die Komintern gilt als eine der wichtigsten politischen Organisationen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihr ursprüngliches Ziel war eine proletarische Weltrevolution, die - basierend auf einzelnen nationalen Revolutionen - alle Länder der Erde ergreifen sollte. Dieses Ziel verlagerte sich jedoch im Verlauf der 1920er Jahre nach dem Scheitern des ‚Deutscher Oktober' - war doch die Durchsetzung der Revolution in Deutschland anfangs als unabdingbare Voraussetzung für den internationalen Erfolg angesehen worden - zu einer Interessenpolitik im Sinne des Stalinismus mit seiner Doktrin vom Sozialismus in einem Land, der Sowjetunion. Das formal oberste Organ der Komintern war deren Weltkongress. Die eigentliche Machtzentrale bildeten jedoch das Sekretariat und das Präsidium des in Moskau eingerichteten Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale (EKKI).
Quelle: www.wikipedia.de
Rudolf Slánský
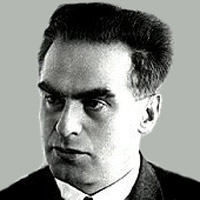
Geboren als Rudolf Salzmann, wuchs er als Sohn eines Händlers in Pilsen auf. Im Jahr 1921, ein Jahr nach seinem Abitur, trat er der Kommunistischen Partei bei und war faktisch ab dieser Zeit Parteifunktionär. 1929 wurde er Mitglied des Zentralkomitees und als Anhänger von Klement Gottwald, der zu diesem Zeitpunkt die Macht in der Partei übernommen hatte, auch des Politbüros. Von 1935 bis 1938 war er Parlamentsabgeordneter, 1938 ging er nach Moskau und wurde dort Mitglied der Auslandsleitung der KSC, in dieser Funktion nahm er 1944 auch am Slowakischen Nationalaufstand teil.
1945 kehrte er in die Tschechoslowakei zurück und wurde im gleichen Jahr Generalsekretär der KSC. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Bekämpfung der demokratischen Parteien und der Machtübernahme der Kommunisten im Februar 1948 beteiligt und für die Verfolgung zahlreicher Gegner der Kommunistischen Partei verantwortlich. Am 8. September 1951 wurde er als Generalsekretär entlassen und erhielt den Posten eines stellvertretenden Ministerpräsidenten. Am 23. November 1951 wurde er verhaftet und des Hochverrats angeklagt.
Die Motivation dürfte einerseits darin zu sehen sein, dass Gottwald sich eines potentiellen Rivalen entledigen wollte, außerdem spielte ein, sozusagen durch das sowjetische Vorbild jener Zeit inspirierter Antisemitismus eine wichtige Rolle. Slánský war wie die Mehrzahl seiner Mitangeklagten jüdischer Herkunft. In einem Schauprozess im November 1952 wurde er als angeblicher "Leiter eines staatsfeindlichen Verschwörungszentrums" zum Tode verurteilt und am 3. Dezember 1952 zusammen mit zehn weiteren Mitangeklagten durch Erhängen hingerichtet. Die Asche der Hingerichteten wurde Streusplitt beigemischt und auf einer Straße bei Prag verteilt.
Quelle: Wikipedia
Tardan
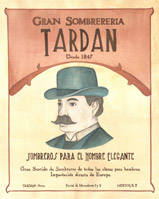
Tardan ist der Name einer 1847 von dem Franzosen Jean Tardan gegründeten Hutfabrik. Ein Freund eines Kunden, dem der Preis für den von ihm gekauften Hut zu hoch war, tötete Tardan in einem Schusswechsel.
Bis heute betreibt Tardan in Mexico City in der Plaza de la Constitución No. 7 ein Ladengeschäft.
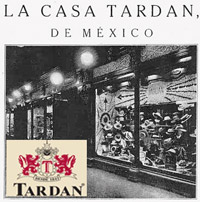 Tardan ist der Schöpfer einer sehr eleganten Art von Herrenhut, der aus Schurwolle oder aber aus Kaninfilz hergestellt wird. Dieses Material macht den Hut dann sogar regenfest und verhindert, dass der Hut seine Form verliert.
Tardan ist der Schöpfer einer sehr eleganten Art von Herrenhut, der aus Schurwolle oder aber aus Kaninfilz hergestellt wird. Dieses Material macht den Hut dann sogar regenfest und verhindert, dass der Hut seine Form verliert.
Nescafé
![]()
Nescafé ist ein löslicher Kaffee (Instantkaffee) der Firma Nestlé. Er ist der meist getrunkene Kaffee der Welt und mit einem Markenwert von 14,8 Mrd. Franken die wertvollste Marke der Schweiz.
Im Jahr 1930 wandte sich erstmals die brasilianische Regierung an die Schweizer Firma Nestlé mit Fragen zur möglichen Konservierung von Kaffee. 1930 ernteten die brasilianischen Kaffeepflanzer so viel Kaffee, dass dieser an der gesamten Küste tonnenweise ins Meer geschüttet wurde, um ein Sinken des Preises auf dem Weltmarkt zu verhindern. Die damals noch kleine und junge Firma hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Namen auf dem Gebiet der Konservierung durch die Haltbarmachung von Frischmilch in Form von Trockenmilchprodukten gemacht.

Ein Forscherteam unter der Leitung von Max Morgenthaler forschte nun nach Möglichkeiten zur Haltbarmachung von Kaffee, so dass nur durch die Zugabe von Wasser das Getränk herzustellen sei, ohne dabei den natürlichen Duft und Geschmack des Kaffees zu verlieren. Nach acht Jahren intensiver Labor- und Entwicklungsarbeit konnte sie erste Erfolge präsentieren und eine Methode vorstellen, die die Kaffeebohnen sowohl qualitäts- als auch aromaschonend zu Pulver verarbeiten konnte und ihn damit haltbar machte.
Hans Jendretzky
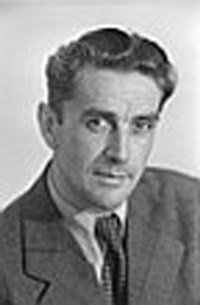
* 20. Juli 1897 in Berlin; † 2. Juli 1992 ebenda - war ein deutscher Politiker (USPD, KPD, SED) in der Weimarer Republik und der DDR.
Der Sohn eines Buchdruckers absolvierte nach der Schule eine Schlosserlehre. 1919 trat er der USPD bei, ein Jahr später wechselte er zur KPD, deren hauptamtlicher Funktionär er 1926 wurde. Er leitete den Roten Frontkämpferbund in Berlin und gehörte von 1928 bis 1932 dem preußischen Landtag an. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten war er von 1934 bis 1938 inhaftiert. Danach konnte er wieder als Schlosser arbeiten, wurde aber 1944 erneut festgenommen.
Nach Kriegsende beteiligte sich Jendretzky am Wiederaufbau der KPD. Im Berliner Magistrat übernahm er die Leitung der "Abteilung Arbeit", die für den Arbeitseinsatz zuständig war. 1946 war er Mitbegründer des FDGB in der sowjetischen Besatzungszone und bis 1948 auch dessen Vorsitzender. Von 1948 bis 1953 hatte er nach der Vereinigung von SPD und KPD die Leitung der Berliner SED inne. Jendretzky war zudem Mitglied des Vorstandes der Gesamtpartei und ab 1950 Kandidat des Politbüros.
Sein politischer Aufstieg wurde 1953 gebremst, nachdem er nach dem Aufstand des 17. Juni seiner Funktionen enthoben wurde. Nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 erfolgte die Rehabilitation. Von 1957 bis 1960 war Jendretzky stellvertretender Innenminister, ab 1957 gehörte er überdies dem Zentralkomitee der SED an. Mitglied der Volkskammer war Hans Jendretzky von 1950 bis 1954 sowie erneut ab 1958. 1965 übernahm er den Vorsitz der FDGB-Fraktion im Parlament.
Sämtliche Parteiämter und Mandate musste er dann im Verlauf der Wende aufgeben.
Quelle: Wikipedia
Schweizer Rechtschreibung ‚ss'
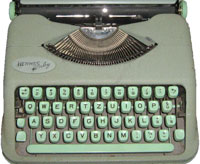
In der Schweiz und in Liechtenstein ist das ß ab 1906 (im schweizerischen Bundesblatt ersichtlich) stufenweise außer Gebrauch geraten und wurde mit der Reform von 2006 auch offiziell für den amtlichen Schriftverkehr abgeschafft. So entschied die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, das ß vom 1. Januar 1938 an in den kantonalen Volksschulen nicht mehr zu lehren. Andere Kantone folgten. Mitauslöser dieser Entwicklung soll die zunehmende Verbreitung der Schreibmaschine gewesen sein. Da mit der Schweizer Einheitstastatur auch französische und italienische Texte geschrieben werden sollten, wurden die Tasten für ß und die großen Umlaute mit französischen Buchstaben (ç,à,é und è) belegt. Diese Begründung ist jedoch bislang nicht belegt.
Als letzte schweizerische Tageszeitung entschied die Neue Zürcher Zeitung (Antiqua seit 1. August 1946), ab dem 4. November 1974 auf das ß zu verzichten. Schweizer Verlage, die für den gesamten deutschen Markt (Sprachraum) produzieren, verwenden das ß weiterhin.
Anstelle von ß wird in der Schweiz immer ss geschrieben. ss steht damit - im Gegensatz zu anderen Doppelkonsonantenbuchstaben - nicht nur nach manchen Kurzvokalen. Wie bei anderen Digraphen (z. B. ch) ist die Länge oder Kürze des vorangehenden Vokals nicht erkennbar (Masse steht sowohl für Maße wie für Masse, Busse steht sowohl für Buße wie für Busse; vgl. hoch und Hochzeit, Weg und weg).
Quelle: wikipedia
Machorka

Machorka ist eine russische Tabaksorte aus dem wilden Tabak Nicotiana rustica (auch „Bauern-Tabak”), der einst von Indianern im östlichen Nordamerika kultiviert wurde und heute fast nur noch in Polen und Russland angebaut wird. Machorka wird üblicherweise nur als selbstgedrehte Zigarette geraucht. Für die Verwendung als Pfeifentabak ist Machorka ungeeignet.
Flucht aus der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR

Flucht aus der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR - im allgemeinen Sprachgebrauch "Republikflucht" - war das Verlassen der DDR oder ihres Vorläufers, der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), ohne Genehmigung der Behörden. Von der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 bis in den Juni 1990 verließen über 3,8 Millionen Menschen den Staat, davon viele illegal und unter großer Gefahr. Etwa 400.000 kehrten im Laufe der Zeit wieder in die DDR zurück. Eingeschlossen sind in diese Zahlen 480.000 seit 1962 legal ausgereiste DDR-Bürger.
Quelle: wikipedia
Aufgrund der Flucht zahlreicher Menschen aus dem eigenen Land stand für die DDR die Existenz auf dem Spiel. "Republikflucht" war für die DDR aus mehreren Gründen ein schwerwiegendes Problem:
- Schäden für die Volkswirtschaft: Der DDR gingen durch die Abwanderung gut ausgebildete Fachkräfte verloren ("Braindrain"), die dringend benötigt wurden. Die Ausbildung der nach 1945 Ausgebildeten war von der DDR finanziert worden;
- ideologische Schäden: die ausreisenden DDR-Bürger leugneten die angebliche Überlegenheit des "real existierenden Sozialismus";
- der Schaden für das außenpolitische Ansehen;
- DDR-Flüchtlinge berichteten in der Bundesrepublik über ihre Fluchtgründe und die Zustände in der DDR (siehe auch Zeitzeuge, Oral History); Medien der Bundesrepublik berichteten darüber und machten damit die wirklichen Zustände in der DDR im Westen bekannter.
1957 verliessen knapp 262.000 Menschen die DDR in Richtung Westen. Am 11. Dezember 1957 wurde von der Volkskammer das Passgesetz geändert. Künftig konnte mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden, "wer ohne erforderliche Genehmigung das Gebiet des DDR verlässt ... oder durch falsche Angaben eine Genehmigung zum Verlassen der DDR erschleicht". Die Justizministerin Hilde Benjamin interpretierte das Gesetz vor der Volkskammer als "Warnung und Schutz unserer Bürger vor der Gefahr, von den Rattenfängern der NATO eingefangen zu werden".
Quelle: www.ddr-wissen.de
Die Regierung der DDR versuchte, die Zahl der "Republikflüchtlinge" einerseits durch sozialpolitische Maßnahmen niedrig zu halten, andererseits aber auch durch massive Abriegelung der Grenzen mit Sperranlagen. Seit der Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und den westlichen Besatzungszonen vom 26. Mai 1952 wurde die innerdeutsche Grenze massiv abgeriegelt, am 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer errichtet.
Juri Gagarin
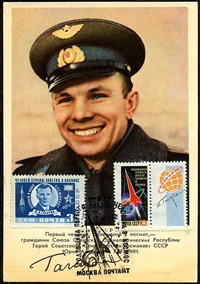
Juri Alexejewitsch Gagarin ( * 9. März 1934 in Kluschino bei Gschatsk, Russische SFSR; † 27. März 1968 bei Nowosjolowo, Oblast Wladimir, Russische SFSR) war ein sowjetischer Kosmonaut, Oberst der sowjetischen Luftwaffe, Held der Sowjetunion und der erste Mensch, der im Weltraum die Erde umrundete.
Als Sohn eines Zimmermanns und einer Melkerin geboren, wurde seine Schulbildung durch den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besetzung seines Dorfes unterbrochen. Nach einem Umzug in die Stadt Gschatsk (heute Gagarin) im Sommer 1945 besuchte Gagarin für sechs Klassen die Mittelschule.
1951 beendete er eine zweijährige Ausbildung an einer Handwerkerschule in Luberzy mit der Facharbeiterprüfung als Gießer. Anschließend studierte er am Industrietechnikum in Saratow und erhielt dort 1955 ein Diplom als Gießereitechniker.
Während des Studiums wurde er Mitglied des Aeroklubs in Saratow. 1955 trat er in die sowjetischen Streitkräfte ein und wurde 1957 zum Leutnant befördert.

1960 wurde Gagarin als potenzieller Kosmonaut ausgewählt und erhielt bis Januar 1961 eine entsprechende Ausbildung. Am 12. April 1961 absolvierte er mit dem Raumschiff Wostok 1 seinen spektakulären Raumflug und umrundete dabei nach offiziellen Angaben in 108 Minuten einmal die Erde. Er landete im Wolga-Gebiet, in der Nähe der Städte Saratow und Engels.
Nach seiner erfolgreichen Landung bei Saratow wurde Gagarin nun in der ganzen Welt bekannt, insbesondere in den Ländern des Ostblocks wurde er zum Idol. Dazu trug nicht zuletzt eine ganze Reihe in der Sowjetunion erschienener, den Prinzipien der Vorbildliteratur gehorchender Gagarin-Biographien bei, darunter auch seine Autobiographie Der Weg in den Kosmos. Seit 1962 wurde der 12. April in Erinnerung an Gagarins Raumflug sowohl in der Sowjetunion als auch im heutigen Russland als offizieller Feiertag begangen, der Tag der Kosmonauten.
Die erste Weltumrundung war ein wichtiger Prestigeerfolg der Sowjetischen Raumfahrt in der Zeit des Kalten Kriegs. Nach dem Sputnik-Schock war dies bereits der zweite Erfolg, und die UdSSR konnte eine technologische Überlegenheit zur Schau stellen. Am 27. März 1968 verunglückte Gagarin bei einem Übungsflug mit einer MiG-15 UTI tödlich. Die genauen Umstände des Absturzes sind bis heute nicht geklärt. Gagarins Urne befindet sich in der Kremlmauer auf dem Roten Platz in Moskau.
Quellen: Wikipedia
Internierungslager Le Vernet

Le Vernet war 1918 - 1945 ein Lager an der N20 zwischen le Vernet d'Ariège und Saverdun in den französischen Pyrenäen. 1918 für senegalesische Kolonialtruppen errichtet, wurde es für österreichische und deutsche Gefangene des Ersten Weltkrieges umgebaut und später als Militärdepot verwendet.
Als im Februar 1939 die Front von Katalonien im spanischen Bürgerkrieg zusammenbrach, zogen sich die republikanischen Truppen nach Frankreich zurück. 12000 Kriegsteilnehmer, wurden bis Ende September 1939 in Le Vernet interniert. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden ab Oktober 1939 als feindlich eingestufte Ausländer und Franzosen nach La Vernet verbracht: deutsche und französische Kommunisten, Italiener, ausländische Juden, Elsässer, Lorrains, Weißrussen, Bolschewiki und belgische Faschisten. (Quelle: nach Wikipedia) Am 29. September 1939 wird letzte Gruppe spanischer Gefangener verlegt. Nun ist Le Vernet nur noch teilweise belegt, und es ist Platz für neue Internierungen vorhanden. Mit Eintritt Frankreichs in den Krieg gegen Deutschland werden massiv deutsche Bürger und ausländische Kommunisten gefangengenommen.
Le Vernet gilt als schlimmstes Internierungslager in Frankreich. Hier war die stärkste Konzentration ausländischer Widerstandskämpfer in Frankreich zu finden, da sich die meisten ausländischen Gefangenen in diesem Lager aufhielten. Hunderte erfahrener Führungspersönlichkeiten, die den europäischen Widerstand unterstützten, kamen aus Le Vernet, das Ausgangspunkt des intellektuellen und antifaschistischen Widerstandes in Europa war. Politische Gruppen waren innerhalb des Lagers organisiert und agierten auch darüber hinaus.
Quelle: nach www.golm.rz.uni-potsdam.de/Seghers/frankreich/Lagerchronik.htm
Le Vernet wurde zum Zentrum und zur Schaltstelle des europäischen Widerstands: Vom Oktober 1939 an befand sich das Lager le Vernet unter "kommunistischer" Führung, eine heimliche Leitung wurde aufgebaut. In der Tat waren verschiedene deutsche Kommunisten, Mitglieder der verbotenen KPD, sowie eine grössere Anzahl Offiziere der Internationalen Freiwilligen-Brigaden in le Vernet interniert worden. Sie stellten eine Art "Mini-Komintern" auf, der es gelang, Verbindungen zur Aussenwelt zu schaffen. Sie organisierten für viele die Flucht aus dem Lager und trugen so dazu bei, dass sich der europäische Widerstand etablieren konnte.
Der kommunistische Widerstand in le Vernet: Die heimliche Lagerleitung setzte sich aus verschiedenen wichtigen Leitern zusammen unter ihnen Franz Dahlem, Nummer 2 in der KPD, Mitglied der Komintern und Stabsoffizier der Internationalen Brigaden. Auch Ljubomir Illich, der sich ebenfalls in Spanien eingesetzt hatte und später zum nationalen militärischen Leiter des MOI wurde. Luigi Longo, General Inspektor der Internationalen Brigaden und späterer Chef der Kommunistischen Partei Italiens. Es wurde alles unternommen, um diesen Persönlichkeiten die Flucht aus dem Lager zu ermöglichen, damit sie zu ihren Zentren des Widerstands in Frankreich selbst und im übrigen Europa zurückfinden konnten.
Quelle: nach www.campduvernet.eu

OdF-Platz

Unter Opfer des Faschismus (OdF) verstand man insbesondere im Sprachgebrauch der DDR die Verfolgten des Nationalsozialismus. Damit wurden sowohl die Ermordeten und Toten bezeichnet, als auch die Überlebenden unter anderem etwa im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes (im Unterschied zu diesem auch die international Verfolgten).
In der DDR gab es genaue Kriterien, wie Inhaftierung oder Berufsverbot, um als anerkanntes Opfer des Faschismus zu gelten. Es gab für die anerkannten OdF innerhalb der DDR keine Wiedergutmachung (Entschädigung), jedoch ab Ende der 1960er Jahre eine Ehrenpension, die als VdN-Rente bezeichnet wurde und die für Berufstätige als Teilrente neben dem Gehalt gezahlt wurde. Weitere Regelungen wie eine jährliche Gesundheitsüberprüfung und Regelungen für die Ausbildung der Kinder kamen hinzu. Eine von den Opfern des Faschismus unterschiedene Gruppe waren die Kämpfer gegen den Faschismus. Beide Gruppen zusammen galten als Verfolgte des Naziregimes (VdN).
Quelle: www.wikipedia.de
Die in der DDR gängige Praxis, die Bezeichnung ‚OdF' zur Benennung von Straßen und Plätzen zu nutzen, glossiert die "Berliner Morgenpost" in der Rubrik ‚Kurioses' im Jahre 2008:

Der rätselhafte Platz "Ort der Familienfeier"? Oder "Olympiade der Frauen"?
Der OdF-Platz in Kleinmachnow hinterlässt den Besucher rat- und erklärungslos. Morgenpost Online erklärt allen Ortsunkundigen die Bedeutung dieser Abkürzung. Für viele Zugezogene aus Westdeutschland ist es ein Rätsel. Der Bus hält am "OdF-Platz" - kein Schild, keine Ansage im Bus löst die Abkürzung auf. Der Zugezogene ist ratlos. Die Einheimischen sind ihm leider keine große Hilfe - denn ihnen geht die Abkürzung leicht über die Lippen. Sie kommen gar nicht darauf, dass jemand nicht wissen könnte, was die drei Buchstaben heißen. Und deshalb erklären sie auch nicht, was sie heißen, sondern verraten nur, was man an dem Platz gut machen kann. Einkaufen nämlich. Denn die Kaufhalle aus Ostzeiten ist mittlerweile durch einen neuen Wohn- und Geschäftskomplex mit allerlei Läden ersetzt. Interessant, findet der Neuling, aber wofür steht nun OdF. Vielleicht "Ort der Familienfeier"? Oder "Olympiade der Frauen"? Des Rätsels Lösung liegt auf dem Platz selbst: Dort gibt es einen Gedenkstein, der an die "Opfer des Faschismus" erinnert - OdF.
Quelle: http://www.morgenpost.de/brandenburg/article993526/Der_raetselhafte_Platz.html
Wahl in der DDR

Ganz eindeutig konstatiert die Internet-Seite www.wahlrecht.de/lexikon/ddr: es bestand keine Wahlpflicht, aber es wurde ein starker gesellschaftlicher Druck ausgeübt.
Anlässlich einer Debatte über eine mögliche Wahlpflicht angesichts sehr niedriger Wahlbeteiligung befand ein Diskussionsteilnehmer:
"Der Wähler ist ein mündiges Wesen. Er hält sich nicht an Meinungsumfragen, er straft Politiker ab, mit denen er unzufrieden ist, er belohnt gute Arbeit - und er bleibt zu Hause, wenn er meint, mit seinem Kreuz keine Wirkung zu erzielen. Denn er ist ein freier Bürger, der sein Wahlrecht nutzt und sich von den Fesseln der Pflicht befreit hat. Das gilt übrigens besonders für die Ostdeutschen, die zwar auch in der DDR keine Wahlpflicht kannten, aber unter einem starken gesellschaftlichen Druck standen, die Einheitslisten zu bestätigen. So erreichte man 99,73 Prozent Wahlbeteiligung zur Volkskammerwahl 1986." (Kölner Stadt-Anzeiger, 28.3.2006)
Auf der Internet-Seite einer Schule in Braunschweig wird von einer Veranstaltung mit Joachim Gauck berichtet, der vor einem Publikum von 6000 Schülern sich über die Lebensverhältnisse in der DDR äußert:
"Joachim Gauck berichtete auch darüber, wie es war, wenn man in der DDR von seinem Wahlrecht Gebrauch machen wollte. Man nannte das Wählen auch "Falten gehen", weil man lediglich den Stimmzettel mit den Namen der Kandidaten vor aller Augen zusammenfalten und in die Wahlurne stecken musste. War man mit der Liste der Nationalen Front nicht einverstanden, so konnte man in die Wahlkabine am Ende des Raumes gehen, zog allerdings alle Blicke auf sich und wurde von allen Leuten angestarrt.
Wenn man nicht Wählen ging, standen stündlich Leute vor der Tür, die einen darauf hinwiesen, dass man noch nicht gewählt habe und dass man es noch tun müsse. Man wurde also zum "Faltengehen" gezwungen."
Quelle: www.masch-news.de
Und auf www.politik-digital.de findet sich unter dem Stichwort "Die Mauer im Mund" eine Sammlung von ostdeutschen Begriffen, die im Laufe der Zeit weitgehend in Vergessenheit gerieten. Zum Thema ‚Politik und Gesellschaft' werden genannt: "Winkelemente Papierfähnchen bei offiziellen Veranstaltungen Bonbon Parteiabzeichen der SED Horch und Guck Stasi Falten gehen wählen gehen DSF Deutsch-Sowjetische Freundschaft Kaderabteilung Personalabteilung Aluminium Mark DDR-Geld Fehlersitzung Krisenrat Subbotnik freiwilliger, unbezahlter Arbeitseinsatz TGL DIN-Norm des Ostens."
Nationale Front

Die Nationale Front der Deutschen Demokratischen Republik (bis 1973 Nationale Front des demokratischen Deutschland) war ein Zusammenschluss der Parteien und Massenorganisationen in der DDR. Durch die Nationale Front sollten dem Anspruch nach alle gesellschaftlichen Gruppen Einfluss auf gesellschaftspolitische Prozesse nehmen können. Faktisch war die Nationale Front jedoch auch ein Mittel, um die Blockparteien und Massenorganisationen zu disziplinieren und die Vormachtstellung der SED im Staat zu festigen.
In den Struktureinheiten der Nationalen Front, den 17.000 Ausschüssen auf unterschiedlichen Ebenen bis hinunter zu den Wohngebietsausschüssen, arbeiteten 300.000 Menschen ehrenamtlich mit. Sie entfalteten an manchen Orten auch lokale Aktivitäten und waren in Zusammenarbeit mit den Stadt- und Gemeinderäten für Ordnung und Sauberkeit in ihren Wohnbezirken verantwortlich. Sie organisierten unter anderem Wertstoffsammlungen und veranstalteten Wohngebietfeste. Die Nationale Front war Trägerin des kommunalen Wettbewerbs Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit! und des Wettbewerbs um die Goldene Hausnummer. Erfolgreiche Kommunen und Hausgemeinschaften

erhielten ideelle und materielle Auszeichnungen wie Geldprämien oder die Ehrennadel der Nationalen Front in Silber oder Bronze. Ziel dieser Aktivitäten war es, Bevölkerungsteile, die sonst nicht in Strukturen wie Parteien oder Massenorganisationen eingebunden waren, zu erreichen und für den "Aufbau des Sozialismus" zu mobilisieren. (Quelle: wikipedia)
Am 8.12.51 führte die Nationale Front eine neue Buntmetall-sammlung im demokratischen Sektor Berlins durch. Der beste Buntmetall-sammler im Kreis Mitte ist der Bäcker Sehm aus der Landwehrstrasse 21, der vom 26.11. - 6.12.51 1990 kg Buntmetall sammelte. Am heutigen Tag sammelte er 380 kg.
Quelle: http://commons.wikimedia.org
Aminophyllin
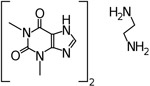
Aminophyllin Aminophyllin ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Methylxanthine. Es ist das Ethylendiamin-Salz des Theophyllins und kann wie dieses als Bronchospasmolytikum bei Asthma bronchiale eingesetzt werden. Es ist allerdings weniger potent und kürzer wirksam und wird daher kaum noch angewendet. Außerdem stimuliert es das Zentralnervensystem, die Diurese und die Magensäuresekretion.
Für die Romanhandlung ist der Hinweis auf die geringe therapeutische Breite dieses Stoffes interessant, wegen der eine Überdosierung schnell zu toxischen Reaktionen bis hin zum Tod führen kann.
Neuendorf

Der Ort, den Ruge in seinem Roman ‚Neuendorf' nennt, ist nicht eindeutig zu bestimmen:
Die am Beginn des Romans genannte A 115 ist im Süden Berlins zu finden, eine der Beschreibung nahekommende Autobahnabfahrt wäre Kleinmachnow.
Eine Straße ‚Am Fuchsbau' ist in vielen Gemeinden in und um Berlin nachzuweisen, so auch in Kleinmachnow, noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft von einer ‚Thälmannstraße'. Google-Kartenausschnitt
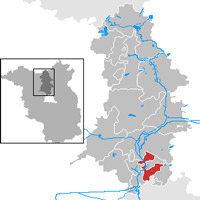
Andererseits ist eine Ortschaft, auf die Charakteristika zutreffen, die im Roman erwähnt werden, die Stadt Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel im Land Brandenburg. Die Stadt mit gut 24.400 Einwohnern liegt an der Havel und grenzt unmittelbar an den Berliner Bezirk Reinickendorf mit dem Ortsteil Frohnau und Glienicke/Nordbahn.
Mit dem Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wurden die Straßen- und Eisenbahnverbindungen zum südlich angrenzenden West-Berlin durch die DDR unterbrochen. Ab November desselben Jahres fuhr die S-Bahn auf einer teilweise neuen Strecke über Blankenburg nach Berlin. Durch die neuen Bahnanlagen wurde die alte Straße vom ehemaligen Bahnhof Stolpe nach Bergfelde unterbrochen. Nach dem Mauerbau wurde der Ort von seiner bisherigen Verkehrsanbindung abgeschnitten und erhielt daher 1962 einen S-Bahn-Anschluss.
Bunte Aluminiumbecher

Quelle: www.dasfundbuero.org
Russenmagazin
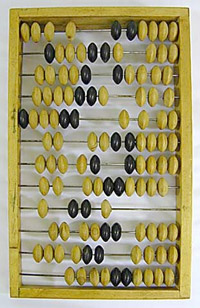
Russenmagazin (von russ.:

= Laden, Geschäft) war in der DDR die umgangssprachliche Bezeichnung für Verkaufseinrichtungen der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, die für deren Armeeangehörige und deren Familien bestimmt waren.
Diese Läden des Militärhandelsunternehmens "Wojentorg" befanden sich meist in größeren Garnisonsstädten in der Nähe des Kasernengeländes, waren aber auch für DDR-Bürger zugänglich, die als Kunden zwar nicht bevorzugt, aber dennoch geduldet wurden und dort Lebensmittel und Gebrauchsgüter, oft sowjetischen Fabrikats, für DDR-Mark kaufen konnten.
Diese Läden waren unter Jugendlichen beliebt, da dort Tabakwaren und Alkoholika ohne Nachfragen an jeden abgegeben wurden. Bis Mitte der achtziger Jahre wurden dort vom sowjetischen Verkaufspersonal die Preise oft noch mit dem Stschjoty zusammen gerechnet, einer russischen Variante des Abakus für den Alltagsgebrauch.
Quelle: Wikipedia (Text), Universität Greifswald (Bild)
Belomorkanal

Die Belomorkanal ist eine Papirossa, in Russland wird der Name bewusst erwähnt, um sie von den modernen Zigaretten abzugrenzen. Eine Papirossa ist zu etwa einem Drittel mit Makhorka gefüllt, einer Tabaksorte die heute nur noch in Russland und Polen angebaut wird und etwa dreimal soviel Nikotin enthält wie Virginia-Tabak. Die restlichen zwei Drittel bestehen aus einem Kartonröhrchen, welches man mit zwei Knicks vor dem Rauchen zu einem Filter (auch Propeller genannt) formt.
Quelle: blog.retrobytes.ch
Vita Cola
Die DDR Colageschichte begann mit Vita Cola, sie war im Geschmack nicht so süß wie viele andere Getränke, leicht säuerlich und viel Kohlensäure. Am 14. Oktober 1954 wurde der Name von den Chemischen Werken Miltitz beim DDR-Patentamt angemeldet, vier Jahre später wurde eine Produktionserlaubnis für das dafür benötigte Konzentrat beantragt.
1958 wurde Vita Cola in der Kategorie "Brauselimonade mit Frucht- und Kräutergeschmack" auf der Herbstmesse in Leipzig präsentiert. Auf Grund lebensmittelrechtlicher Bestimmungen musste die in über 200 DDR-Getränkebetrieben abgefüllte Vita Cola als "koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit 50 mg Vitamin C" bezeichnet werden.
Die Regierung der DDR forderte im zweiten Fünfjahresplan die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit alkoholfreien Getränken. Daraufhin beauftragte das Ministerium für Lebensmittelindustrie die Chemische Fabrik Miltitz mit der Entwicklung eines Cola-Getränkes, welches der Coca-Cola aus Nordamerika entsprechen sollte. Als Vater der Vita-Cola-Rezeptur gilt Hans Zinn, Abteilungsleiter Essenzen, der Chemischen Fabrik Miltitz. Er kreierte den Geschmack des Getränkes durch die Kombination einer Vielzahl ätherischer Öle wie beispielsweise Zitrusöl, Vanille, Kolanüssen, Koffein und Vitamin C.

Im Oktober 1958 wurden die ersten Kilogramm des Grundstoffes an die Landesbrauerei Leipzig (später VEB Sachsenbräu) ausgeliefert. Das Warenzeichen für das Endprodukt meldete die Brauerei im November 1958 beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen der DDR an.
Bild: Vita-Cola-Etikett der Feldschloss-Brauerei Lübben, um 1965
Um der großen Nachfrage der Verbraucher Herr zu werden, genehmigte die Landes-Brauerei auch anderen Volkseigenen Betrieben die Verwendung des Namens Vita-Cola für den Grundstoff und für den Limonadensirup. Bereits im Jahr 1960 erhielten 106 Betriebe die Produktionserlaubnis. Da jede DDR-Brauerei die Cola mit einem anderen Etikett vermarktete, war das Erscheinungsbild am Markt sehr unterschiedlich. Der Inhalt blieb jedoch immer gleich.
Quelle: www.ddrtechnik.de
Pelmeni
Zubereitung (für 4 Personen)
|
1 Ei |
Für den Nudelteig: Für die Füllung: |
"Club"
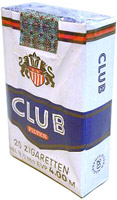
Zu DDR-Zeiten war "die Club" eine der höherpreisigen Filterzigaretten. Der Preis betrug 4,- Mark pro Packung, während die meisten anderen Filterzigaretten in der Spanne von 2,50 Mark bis 3,20 Mark gehandelt wurden. Die Marke galt als die von der Intelligenz gerauchte Zigarette.
Quelle: www.pionierrepublik.de
Haus der Offiziere

Das Theater Karlshorst hat eine besondere Geschichte. Es ist das einzig überlieferte Bauwerk dieser Art in Berlin der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) und der erste Nachkriegs-Theaterneubau in Deutschland. Das "Haus der Offiziere", im Volksmund "Russen-Oper" genannt, wurde 1948/49 als Reparationszahlung von den Deutschen errichtet. Das Gebäude - ein seltenes Beispiel für stalinistische Architektur in Karlshorst - war die Kulturstätte für Angehörige der Roten Armee, die in Karlshorst stationiert waren.
Im "Haus der Offiziere" standen weltberühmte Künstler wie David Oistrach, die legendäre Primaballerina Galina Uljanowa und das Ensemble der Peking-Oper auf der Bühne. Weil in das Theater nur sowjetische Militärangehörige und Zivilangestellte sowie deren Familien rein durften, verpassten die Karlshorster ihm den Namen "Russen-Oper". Im Haus befand sich auch der Club "Wolga". Seit den 70-er Jahren konnte das Gebäude dann auch von Deutschen genutzt werden. Viele haben in dem Saal ihre Jugendweihe erhalten. Außerdem gab es hier regelmäßig Kinovorführungen.Quelle: www.theater-karlshorst.de
Neues Deutschland

Das Neue Deutschland (Abkürzung: ND) war von 1946 bis 1989 das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).
Das Neue Deutschland entstand als Lizenzzeitung 1946 im Zuge der von der sowjetischen Militärverwaltung (SMAD) betriebenen Zwangsvereinigung von SPD und KPD der damaligen sowjetischen Besatzungszone zur SED. Von der SMAD wurde eine Auflage von 400.000 Exemplaren mit einem Umfang von vier Seiten genehmigt. Die erste Ausgabe des "Zentralorgans der SED" erschien am 23. April 1946, im Anschluss an den Gründungsparteitag, und ersetzte Parteizeitungen der SPD (Das Volk) und der KPD (Deutsche Volkszeitung), die ihr Erscheinen einstellten. Der Name Neues Deutschland ist auf die damalige Bestrebung der deutschen Kommunisten zurückzuführen, ein anderes, antifaschistisches, sozialistisches, eben neues Deutschland aufzubauen. Als der Begriff Deutschland vor dem Hintergrund der Zwei-Staaten-Theorie um 1970 in der DDR problematisch wurde, wurde zunehmend die Abkürzung ND bevorzugt.
Vor der deutschen Wiedervereinigung hatte das ND eine Auflage von einer Million Exemplaren und war damit nach der Jungen Welt die DDR-Tageszeitung mit der zweithöchsten Auflage.
In der DDR war die Zeitung eines der wichtigsten Propagandawerkzeuge der SED und des von ihr beherrschten Ministerrates. Die Konzentration auf die Partei- und Staatsführung der DDR ging so weit, dass in einer Ausgabe vom 16. März 1987 anlässlich der Eröffnung der Leipziger Messe 41 Fotos von Erich Honecker, dem damaligen Staatsratsvorsitzenden und Generalsekretär des ZK der SED, zu sehen waren. Den innerhalb der SED-Nomenklatura sehr einflussreichen Posten des ND-Chefredakteurs bekleideten neben anderen die Spitzenfunktionäre in Partei- und Staatsapparat Rudolf Herrnstadt, Georg Stibi, Hermann Axen, Joachim Herrmann und Günter Schabowski. Im Gegensatz zu den sonstigen DDR-Tageszeitungen verfügte das Neue Deutschland über ein größeres Format und eine überdurchschnittliche Papier- und Druckqualität.
Quelle: www.wikipedia.de, Konrad-Adenauer-Stiftung
Ein Titelblatt der Zeitung Neues Deutschland vom 18.Juni 1953
Bonzen

Der Ausdruck "Bonze" bezeichnete ursprünglich einen buddhistischen Mönch oder Priester und stammt aus dem Japanischen.
Im 19. Jahrhundert bekam das Wort dann im Deutschen eine weltliche Bedeutung und wurde auf Staatsmänner, Vorgesetzte und Inhaber von hohen Ämtern angewendet. Um 1890 wurde es außerdem innerhalb der Arbeiterbewegung zu einer spöttischen Bezeichnung für die sozialdemokratischen Inhaber von staatlichen oder kommunalen Ämtern sowie für Gewerkschaftsfunktionäre.
Dieser Bezeichnung liegt gleichsam der Vorwurf zugrunde, die Führer seien verbürgerlicht, der Masse und ihren revolutionären Neigungen entfremdet. Die Bezeichnung ist schließlich auch von den Gegnern des Sozialismus als Schlagwort gegen dessen Führer aufgegriffen worden.
In derselben Verwendung zur Schmähung von korrupten Parteifunktionären wurde es auch von linken Intellektuellen benutzt, z.B. von Kurt Tucholsky oder von Hans Fallada in seinem Romantitel "Bauern, Bonzen und Bomben".
Quelle: www.wikipedia.de
T 34
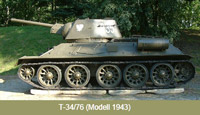
Der T-34 ist ein sowjetischer Panzer, der von 1940 bis in die 1950er-Jahre gebaut wurde. Hauptsächlich wurde er zwischen 1941 und 1945 beim Zurückschlagen des Überfalls auf die Sowjetunion eingesetzt.
Der T-34 vereinigte bereits bekannte, moderne Ideen zu einem für seine Zeit sehr guten und fortschrittlichen Panzer. Der T-34 war der erste Panzer, der Feuerkraft, Panzerung und Beweglichkeit ausgewogen miteinander verband.
Quelle: www.wikipedia.de
Mottenpulver - Naphthalin

Geruchsintensive Substanz und wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Farbstoffen, Gerbstoffen, Insektiziden und Pharmaka. Hauptwirkstoff von Mottenpulver/-kugeln, in denen es als Atemgiftstoff zu Insektenabwehr eingesetzt wird.
Die letale Dosis (oral) liegt für den Menschen bei 5 g. Naphthalin führt auf der Haut zu starken Reizungen und zur Dermatitis. Naphthalin kann die roten Blutzellen schädigen. Beim Einatmen kann es zu Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen und Übelkeit, Erbrechen und Verwirrtheitszuständen führen. Bei Einnahme führt es zu Magen-Darm-Störungen, Atemlähmung, Krämpfen und Tremor. Eine Schädigung der Augenhornhaut, der Leber und Nieren ist möglich. Eine krebserregende Wirkung wird vermutet.
Quelle: www.wikipedia.de
Dederon

Dederon (als Marke meist DEDERON) war der Handelsname von Polyamidfasern in der DDR. „Dederon“-Fasern wurden u. a. im VEB Chemiefaserkombinat „Wilhelm Pieck“ in Rudolstadt-Schwarza, im VEB Chemiefaserwerk „Herbert Warnke“ in Wilhelm-Pieck-Stadt Guben und im VEB Kunstseidenwerk „Friedrich Engels“ Premnitz hergestellt.
„Dederon“ ist ein nach dem Vorbild „Perlon“ geprägtes Kunstwort, das sich aus DDR und „on“ zusammensetzt. Besondere Bekanntheit erlangte Dederon durch die berühmten Kittelschürzen und Einkaufsbeutel; auch wurde am 12. März 1963 ein Briefmarkenblock Chemie für Frieden und Sozialismus aus Dederonfolie herausgegeben.
Quelle: wikipedia
Fluchen auf Russisch

‚Nu tschjort poderi!' - Zum Teufel! Vergleichsweise harmlos, doch es reicht, um Irinas Mutter in Angst und Schrecken zu versetzen. Warum fluchen die Russen? Russisch war immer reich an Schimpfwörtern. Es existiert eine Theorie, dass die Schimpfwörter zur Zeit der Mongolotataren (12. Jh.) in der russischen Sprache erschienen. Vielleicht versucht man mit dieser Theorie das "schlechte Gewissen" zu beruhigen, dass die Leute eine der schönsten Sprachen der Welt mit Schimpfwörtern verdorben haben.
Die Sprachwissenschaftler sind aber anderer Meinung. Fast alle russischen Schimpfwörter sind slawischer Herkunft und waren ursprünglich, viele Jahrhunderte davor, überhaupt keine Schimpfwörter. Als Russland christianisiert wurde, hat die Kirche die Leute, die "schlimme Wörter" benutzt haben, verdammt. In der Sowjetzeit waren Schimpfwörter und ihr literarischer Gebrauch absolut tabu. In der postsowjetischen Zeit wurde alles, was früher tabu war, willkommen geheißen bzw. als "cool" empfunden. Früher waren alle Russen "Atheisten", heute sind die Kirchen voll von Menschen. Früher hat man gesagt: "In unserem Land gibt es keinen Sex", heute sind die Grenzen zwischen Erotik und Pornographie in Russland ziemlich fließend. Früher konnte man für Schimpfen auf der Straße wegen "Banditismus" 15 Tage ins Gefängnis gesteckt werden, heute ist die Benutzung von Kraftausdrücken "modern" geworden. (Quelle: www.russian-online.net)
Kamilit - Mineralwolle

Als Mineralwolle werden Dämmstoffe (siehe auch Wärmedämmung) aus Glaswolle und Steinwolle bezeichnet, umgangssprachlich auch Kamelit oder Kamilitwolle genannt. Mineralwolle ist ein besonders wirksamer, nichtbrennbarer Dämmstoff. Er ist vielseitig einsetzbar vom Keller bis zum Dach, im Neubau und bei der Modernisierung, im Wohnungs- und Gewerbebau und der Dämmung von Industrieanlagen.
Kamilit ist ein Faserprodukt, bei dessen Herstellung und Verarbeitung sowie beim Umgang mit ihm auch lungengängige Fasern (Durchmesser kleiner als 3 µm, Länge größer als 5 µm, Verhältnis von Länge zu Durchmesser ist größer als 3 zu 1) entstehen bzw. frei werden können. (Quelle: Dipl.-Ing. Lutz Peter, Landesamt für Soziales und Familie, Abt. 2 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Suhl: Abbruch und Rückbau von Plattenbauten aus der Sicht des Gefahrstoffschutzes - e-pub.uni-weimar.de/opus4/files/694/SR8-09.pdf)

Die groben Fasern der Mineralwolle (dicker als 3 µm) führen bei Hautkontakt zu Hautreizungen und bei den meisten Menschen zu Juckreiz. Menschen mit empfindlicher Haut können auch stärkere Reizreaktionen haben (Rötung, Schwellungen u.ä.). Stäube der Mineralwolle sind als 'möglicherweise krebserregend' eingestuft. In empirischen Untersuchungen an Arbeitern konnte dies allerdings bisher nicht nachgewiesen werden, wohl aber in einem speziellen Tierversuch. (Quelle: Wikipedia)
Irinas Gedanke, alles sei "vergeblich", bezieht sich natürlich auf die gegenwärtig ablaufende ‚Rückübertragung' (vgl. den entsprechenden Dossiereintrag), die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass sie aus ihrem Haus ausziehen muss.
Slawa = Soswa

Die Stadt, in der Irina zur Welt gekommen ist, wo sie Kurt kennengelernt hat, von wo aus sie ihre Mutter Nadeshda Iwanowna in die DDR holt, wird im Roman Slawa genannt. Man kann es als eine dichterische Verhüllung des Geburtsorts von Eugen Ruge nehmen, Soswa, gelegen im Oblast Swerdlowsk im nördlichen Ural. Slawa, auch als Koseform von männlichen Vornamen benutzt, bedeutet auf Russisch Ehre oder Reichtum.
Die reale Siedlung Soswa liegt im Westen des Westsibirischen Tieflandes, gut 260 km Luftlinie nordöstlich der Oblasthauptstadt Jekaterinburg am linken Ufer der Soswa. Soswa gehört zum gleichnamigen Stadtkreis Soswa (zuvor Rajon Serow), und liegt 85 km südöstlich von dessen Verwaltungszentrum Serow. Soswa wurde 1880 gegründet und wird seit 1938 als ‚Siedlung städtischen Typs' bezeichnet. 2009 hatte dieser Ort keine 10.000 Einwohner.
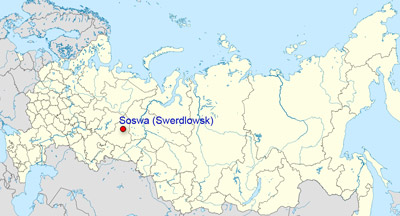
1880 wurde auf den Ländereien des Dorfes Koschai mit der Errichtung des Eisenwerkes Soswinski Sawod ("Soswa-Werk") begonnen, aus dessen Werkssiedlung sich das heutige Soswa entwickelte. Das Werk wurde 1927 bereits wieder geschlossen, an seiner Stelle jedoch ein "Holzverarbeitungs-Kombinat" errichtet. Am 16. November 1938 erhielt der Ort unter dem heutigen Namen des Status einer Siedlung städtischen Typs.

Von 1941 bis mindestens 1960 befand sich in Soswa die Verwaltung des Nordural-Straflagers (SewUralLag) im System der Gulag mit zeitweise mehr als 33.000 Häftlingen, die in der Holzgewinnung und -verarbeitung sowie bei Bauarbeiten und in diversen Industriebetrieben eingesetzt wurden. Bis heute existiert in Soswa ein größeres Straflager.
Die Wirtschaftstätigkeit in diesem Straflager ist folgendermaßen zu spezifizieren:
- Holzbeschaffung - Bau eines einfachen Zellstoffwerks in der Nähe von Turinsk und des Hydrolysewerks Tawda
- Bau des Pressschichtholz-Kombinats Tawda
- Herstellung von zwei Öfen zur Holzverkokung (für die Entwicklung der Holzkohlemetallurgie im Ural)
- Herstellung von Ski-Rohlingen und Skiern, Holzverarbeitung, Produktion von Eisenbahnschwellen, Möbelherstellung, Bekleidungsproduktion und Schuhherstellung
- landwirtschaftliche Arbeiten
- Bau von Zentralen Reparaturwerkstätten der Hauptverwaltung der Lager in der Holzwirtschaft (GULLP)
- Betrieb von Reparaturwerkstätten im Schiffsreparaturhafen Soswa und von anderen technischen Werkstätten, von Fuhrparks, eines Lokomotivdepots und der Motorbootflotte,
- Bau und Betrieb von Schmalspurbahnen,
- Flößereiarbeiten sowie Be- und Entladungsarbeiten, Brennholzbeschaffung
Quelle: wikipedia.de; Das System der Besserungsarbeitslager in der UdSSR 1923-1960. Handbuch. Hrsg. Michail Smirnow
Maltschik Paltschik
|
Es gibt ein russisches Fingerspiel, bei dem der Erwachsene nacheinander die Finger vom Kind ergreift währenddessen den folgenden Spruch aufsagt: |
Junge-Däumling - Wo warst du? |
Dieses Gedicht mit dem dazugehörigen Spiel ist unter dem Namen Junge-Däumling Spaß in Russland jedermann ein Begriff. Und gern wird eine russische Babuschka ein kleines Kind mit diesem Spielchen stundenlang beschäftigen.
Tatsächlich gibt es noch eine russische Variante zum Däumlings-Märchen von Charles Perrault mit dem Titel:
'Maltschik s Paltschik'
Ein Großmütterchen hat sich beim Kohlhacken den kleinen Finger abgehackt. Sie hat ihn eingewickelt und auf ein Brett gelegt. Aus diesem Fingerchen ist ein kleiner Junge geworden, ein sehr, sehr kleiner Junge. Deshalb hat man ihn ‚Maltschik s Paltschik' genannt, so groß wie ein Fingerchen. Der Junge wuchs auf, blieb zwar sehr klein, wurde dafür aber sehr klug. Er hat bei der häuslichen Arbeit geholfen, war sehr pfiffig. Er hat auch dem Vater auf dem Acker geholfen, indem er dem Pferd ins Ohr kroch und es leitete. Das machte den Eindruck, dass das Pferd selbstständig den Acker pflügte. Der Junge sagte dem Vater, dass er ihn ruhig verkaufen sollte, falls ihn jemand darum bitten würde. So ist es auch geschehen: ein reicher Mann hat dem Vater 1000 Rubel für den Jungen geboten - und ihn dann in seine Tasche gesteckt. Der Junge ist ihm aber unterwegs durch ein Loch in der Tasche entflohen. Später hat ein Wolf den Jungen verschluckt. Aber der Junge hat in dessen Bauch so geschrien, dass der Wolf kein Schaf fressen konnte: der Junge hat auf solche Weise die Hirten gewarnt. Da bat der Wolf, der inzwischen sehr mager geworden war und vor Hunger fast starb, den Jungen, aus seinem Bauch herauszukriechen. Der Junge hatte eine Bedingung: der Wolf sollte ihn nach Hause bringen. Der Wolf lief zu den Eltern des Jungen, hier ist der Junge aus dem Bauch des Wolfs herausgesprungen und hat geschrien: "Erschlagt den Wolf!" So hat man den bösen Wolf getötet, und aus seinem Fell hat man dem Jungen einen Pelzmantel gemacht.
Diese russische Version des französischen Märchens ist in Russland sehr populär, und hier können Sie wählen zwischen zwei Zeichentrick-Fassungen des Stoffes: einmal eine moderne Interpretation von 2006, und dann ein Film von 1938, aus der Stalinzeit, der Epoche, die für Nadeshda Iwanownas Biographie so bedeutungsvoll ist! Quellen: www.youtube.com
|
moderne Interpretation von 2006 |
Film von 1938 |
Das Lied vom Zicklein
Es handelt sich um ein sehr populäres russisches Volkslied: Es lebte beim Großmütterchen eine kleine graue Ziege. Leider ereilt dieses unternehmungslustige Zicklein ein sehr trauriges Schicksal, wie die folgende Übersetzung des Liedertextes zeigt.
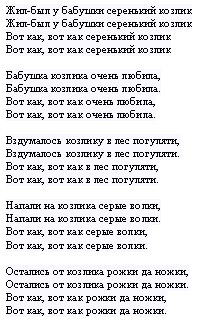 |
Es lebte beim Großmütterchen ein graues Zicklein, … Das Großmütterchen hat das Zicklein sehr geliebt, … Es kam dem Zicklein in den Sinn, spazieren zu gehen, … Überfielen das Zicklein graue Wölfe, … Geblieben sind vom Zicklein nur Hörnlein und Hüflein, … |
Zwei verschiedene Fassungen dieses Liedes können wir hier anbieten: die moderne Version stammt vom live-Auftritt einer populären russischen Band, entsprechend verfremdet ist die moderne Interpretation dieses traditionellen Stücks.
| die moderne Version | die traditionelle Version |
Socken
Auf die traditionelle Weise handgestrickt, wie im Roman von Nadjeshda Iwanowna gearbeitet, nämlich mit dem dreigeteilten Käppchen!
100 g Sockenwolle vierfädig - Lauflänge ca. 210 m auf 50 g
1 Nadelspiel 2,5 oder 3 - wer ein sehr feines Maschenbild möchte, kann auch 2 nehmen
Maschenanschlag 60 Maschen für Schuhgrößen 36 bis 40; 64 Maschen ab Größe 40: Damenfüße also eher 60, Herrenfüße eher 64 - aber immer durch 4 teilbar.
Auf die 4 Nadeln des Spiels verteilen. Wenn man auf die erste Nadel weniger Maschen nimmt, weiß man genau, wo die Runde beginnt. Also z.B. 12 Maschen, 16, 16, 16 Maschen; bzw. 12 Maschen, 16, 16, 20 Maschen.
Den Schaft in beliebiger Länge in Runden hochstricken, entweder vollständig im Bündchenmuster 2 rechts, 2 links, oder aber nur einen Teil als Bündchen - Länge nach Geschmack, und dann glatt rechts. Wenn man jeweils die erste der beiden Rechtsmaschen verschränkt strickt, also schräg von rechts nach links seitlich in die Masche einsticht, dann sieht das Bündchen besonders glatt und ordentlich aus.
Wenn das Bündchen die gewünschte Länge hat (bei Damensocken gewöhnlich ca. 80 Runden, bei Herrensocken etwa 90 Runden), die Maschen gleichmäßig auf die 4 Nadeln verteilen, also 15, 15, 15, 15 Maschen bzw. jeweils 16 Maschen. Der Schaft ist fertig.

Jetzt folgt die Ferse: am Ende der letzten Schaftrunde sind wir in der hinteren Mitte. Wir stricken die erste Nadel, also 15 bzw. 16 Maschen ab, wobei die letzte Masche bei vorne liegendem Faden abgehoben wird. Darauf achten, dass man sehr stramm strickt, damit bei der Ferse keine Löcher entstehen. Die Arbeit wenden.
Die jetzt folgende Rückreihe ist die 1. Reihe der Ferse. Die Randmasche rechts verschränkt abstricken: Nadel schräg von rechts nach links in die Masche einstechen und mit dem jetzt hinten liegenden Faden sehr stramm abstricken. Die Maschen von 2 Nadeln = 30 Maschen bilden die Ferse. Nach 2 - 3 Reihen kann man diese Maschen auf eine gemeinsame Nadel geben, solange man mit der Ferse beschäftigt ist. Am Ende der 2. Nadel wieder die letzte Masche abheben, bei vorne liegendem Faden. Wiederum sehr stramm stricken.
Die Maschen der 2. und 3. Nadel bleiben liegen, sie werden stillgelegt und werden erst wieder benötigt, wenn die Ferse fertig ist und der Spann in Angriff genommen wird.
Folgende Variationen des Fersenrandes sind zur besonderen Betonung möglich: Nach der Randmasche 3 Maschen glatt links stricken.
Oder aber jeweils in der Rückreihe - links gestrickt - nach der Randmasche 1 Masche links, dann 1 Masche rechts, weiter links, bis zum Ende der Reihe, dann gegengleich 1 Masche rechts, 1 Masche links, Faden nach vorn, letzte Masche abheben, Arbeit wenden.
Natürlich ist es auch möglich, den Rand der Ferse ganz ohne Akzent zu stricken, also die gesamte Ferse glatt rechts.
Höhe der Ferse 26 Reihen bei Damensocken, 28 bei Herrensocken. Jetzt ist die Ferse fertig.

Es folgt das Käppchen: die 1. Reihe ist eine Rückreihe, also von der linken Seite. Die Maschenzahl wird im Geist durch 3 geteilt: es sind also 30 Maschen, nämlich 3 x 10 Maschen auf der Nadel. Bei den Herrensocken werden die überzähligen Maschen dem mittleren Drittel zugeschlagen.
Es wird ein Drittel der Maschen gestrickt, also Randmasche + 9 Maschen bei der Damensocke; weiter in der gleichen Richtung noch einmal 9 Maschen = 2. Drittel. Dann werden die 10. Masche des 2. Drittels und die 1. Masche des 3. Drittels links zusammengestrickt: sehr stramm stricken, damit keine Löcher entstehen!
Die Arbeit wenden. Die 1. Masche abheben, dann die Maschen des mittleren Drittels rechts abstricken, dabei die letzte Masche dieses mittleren Drittels wie zum Rechtsstricken abheben, die 1. Masche des 3. Drittels rechts stricken und die abgehobene Masche überziehen. Arbeit wenden. Immer daran denken, den Faden sehr energisch anzuziehen, damit später keine Löcher entstehen.
In dieser Weise wird immer hin und her gestrickt, bis links und rechts alle Maschen verbraucht sind und nur noch die 10 Maschen des mittleren Drittels auf der Nadel sind. Wir enden mit einer rechten Reihe. Jetzt ist das Käppchen fertig.
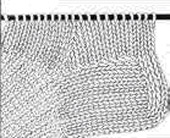
Jetzt kommt der Fußteil: glatt rechts in Runden stricken, bis bei einer Anprobe die breiteste Stelle des Fußes etwa beim Ballen erreicht ist. Bei Schuhgröße 37 sind das von der Neuaufnahme der Maschen vom Fersenrand aus gezählt meistens um die 50 Runden. Aber auf jeden Fall probieren: Je nach Strickfestigkeit fällt jede Socke unterschiedlich groß aus!
Jetzt kommt die Fußspitze, die mit einer Bandabnahme gearbeitet wird.
Die 1. Nadel wird rechts abgestrickt, die vorvor- und die vorletzte Masche werden rechts zusammengestrickt, die letzte Masche rechts gestrickt.
Bei der 2. Nadel wird die 1. Masche rechts gestrickt, die 2. Masche rechts abgehoben, die 3. Masche rechts gestrickt, die 2. Masche übergezogen, die restlichen Maschen auf dieser Nadel glatt rechts gestrickt.
Bei der 3. Nadel wiederum die vorvor- und die vorletzte Masche rechts zusammengestrickt, bei der 4. Nadel erneut die 2. Masche abgehoben, die 3. gestrickt, die 2. übergezogen.
Die Fußspitze soll ganz allmählich schmaler werden. Deshalb folgende Anordnung der Abnahmen: 1. Runde die Abnahmen entsprechend der obigen Beschreibung. Dann 2 Runden ohne Abnahmen. Diesen Vorgang 3 mal durchführen.
Dann 3 mal in der Reihenfolge 1 Runde mit Abnahmen, jeweils danach 1 Runde ohne Abnahmen.
Dann in jeder Runde die Abnahmen, bis nur noch 8 Maschen, also 2 Maschen auf jeder Nadel sind. Damit die Nadeln sich nicht selbstständig machen, diese 8 Maschen auf 2 Nadeln verteilen, ist besser in der Handhabung!
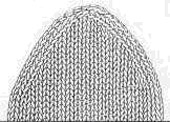
Jetzt ist die Socke fertig und muss nur noch vollendet werden: den Faden ca. 10 cm abschneiden und in eine dicke Stopfnadel fädeln. Diesen Fadenrest in 2 Runden durch die Maschen ziehen. Das Fadenende durch das winzig kleine Löchlein in der Mitte auf die linke Seite ziehen und auf der Rückseite sorgfältig vernähen.
FERTIG!!! Jetzt zügig die 2. Socke arbeiten, damit man nicht vergisst, wie und wo man was gemacht hat!
(Es hatte sich herausgestellt, dass meine Studentinnen an der Universität in Kasachstan, wo ich vier Jahre gearbeitet hab, das Sockenstricken nicht mehr beherrschten. Da hab ich seinerzeit in den 90ern diese ausführliche Anleitung für meine ‚djewuschki' aufgeschrieben.)
Krieg und Frieden

Krieg und Frieden (russisch Woina i mir) ist ein vierteiliger historischer Roman des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi. Er erschien zuerst 1868/69 in Moskau und gilt als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur.
Der Roman wurde weltberühmt, weil er wie unter einem Brennglas die Zeit von 1805 bis 1812 aus russischer Sicht in einzigartiger Geschlossenheit darstellt. Es wird fast ausschließlich aus der Perspektive einzelner russischer Adliger erzählt, die sich wechselseitig beeinflussen. Es werden Schlachten (beispielsweise die Schlacht bei Austerlitz oder die Schlacht von Borodino) beschrieben, wichtige historische Begebenheiten wie der Brand Moskaus im Jahr 1812, aber auch Teestunden, Bälle, Jagden, Konferenzen und Volksaufläufe.
Dabei nimmt der Verfasser weitgehend eine allgemeine Position ein, aus der er auch historische oder militärtheoretische Überlegungen anstellt. Viele Szenen, hauptsächlich die Diskussionen und Gespräche innerhalb der Adels- und Regierungskreise in St. Petersburg, sind auf Französisch geschrieben, der damals im russischen Adel vorherrschenden Sprache. Tolstoi zeichnete ein detailgetreues Abbild des russischen Adels, an den sich der Roman auch richtete, wobei er einige Figuren des Romans nach real existierenden Personen zeichnete, beispielsweise Fürst Kutusow oder die Adelsfamilie Wolkonski, die er im Roman Bolkonski nennt.
Auch Tolstois eigene Familiengeschichte, philosophische und geschichtswissenschaftliche Überlegungen und historische Anekdoten sind in das Werk mit eingebunden. Der Roman betrifft indirekt auch gesellschaftliche Probleme, zum Beispiel die Gegensätze zwischen Adel und Geldadel, zwischen ehelicher und unehelicher Geburt etc.
In Krieg und Frieden gibt es zahlreiche Handlungsstränge und rund 250 Personen, auf die näher eingegangen wird. Der Roman spielt zwischen 1805, dem Beginn des dritten Koalitionskrieges gegen Frankreich und 1812, dem Jahr, in dem Napoleons Russlandfeldzug scheiterte. In diesem Umfeld gibt es zwei Hauptpersonen, den Fürsten Andrej Nikolajewitsch Bolkónski und Pierre, den späteren Grafen Peter Besúchow, die im Laufe des Romans nach dem Sinn des Lebens und nach ihrer Bestimmung suchen. Quellen: Wikipedia
Rastjopa

russisch ‚Äch ty, rastjopa' - Nadjeshda Iwanowna schimpft mit sich selbst: Was bist du doch für ein Dummkopf! ‚rastjopa' bezeichnet einen Tollpatsch oder eine Schlafmütze, jemand der ungeschickt oder zerstreut ist und deshalb alles falsch macht.
Vor- und Vatersnamen
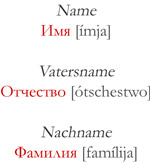
Russische Namen
Russische Namen bestehen aus drei Teilen: Vorname, Vatersname und Nachname.
Beispiele:
- Alexander Sergejewitsch Puschkin
- Fjodor Michajlowitsch Dostojewski
- Anna Andrejewna Achmatowa
Der Vatersname wird im Russischen vom Vornamen des Vaters abgeleitet. Beispiel: ein Mann mit dem Vornamen Wladimir hat einen Sohn Aleksej und eine Tochter Svetlana. Der Sohn hieße dann Aleksej Wladimirowitsch und die Tochter Svetlana Wladimirovna.
Russische Namen richtig gebrauchen:
- Die Kombination aus dem Vornamen und Vatersnamen ist die höflichste Form der Anrede in Russland. So werden, zum Beispiel, Geschäftspartner, Vorgesetzte, Kollegen, ältere Menschen und Menschen, die man noch nicht so gut kennt, angesprochen. Es ist unüblich, jemanden auf Russisch mit Herr / Frau plus Familienname anzusprechen. Diese Form der Anrede setzt sich aber unter westlichem Einfluss in der schriftlichen Kommunikation mehr und mehr durch.
- In der Familie, unter Freunden oder guten Bekannten wird man in Russland meistens mit der Kurzform des Vornamen angesprochen.
- Die Anrede mit dem Kosenamen ist sehr familiär. Meistens werden russische Kosenamen in der Familie, unter sehr engen Freunden oder Verliebten benutzt.
- Russische Namen haben noch eine Form, die je nach Situation als verächtlich oder familiär bezeichnet werden kann. Diese Form wird mit dem Suffix -k- gebildet.
Zum Beispiel, Marina - Marinka Wolodja - Wolodka
Wer noch kein Gefühl für die Verwendung der verächtlich-familiären Form hat, sollte sie lieber nicht nutzen, um niemanden aus Versehen zu beleidigen.

Die russischen Vornamen sind sehr verwirrend. Eine Frau stellt sich vor als Maria und dann stellt man fest, dass sie auf die Rufnamen: "Maschenka, Manja und Mussja" reagiert. Generell, die Russen mögen ALLES verniedlichen.
Wanjetschka und Manjetschka
Die verniedlichten Namensformen werden nicht nur für Kinder verwendet. Nennt man sich beim Vornamen, so wird selten der volle Name verwendet, sogar wenn man sich siezt. Jede Natalja ist Natascha, Iwan ist Wanja, gar Wanjuscha oder Wanjetschka und Maria ist Mascha, Maschenka, Marussja, Mussja und Manjetschka.
Welchen Vornamen soll man also nennen? Wenn man die Person nicht gut kennt, am besten den, mit dem die Person sich selbst vorgestellt hat.
"Wanjachen und Maschalein"
Meistens (aber nicht immer) werden die Kosenamen von Verkleinerungsformen gebildet. Wie auch bei allen Substantiven werden die bestimmten Suffixe angefügt. Diese entsprechen den deutschen Nachsilben "-chen" und "-lein". Kätzchen, Fischchen und Schwälbchen sind die meistgebräuchlichsten Tierbezeichnungen für eine Person als Kosename.
- lasstatschka (die Schwalbe) : Das Wort hat sogar auf Russisch nur die Verkleinerungsform!
- Das Kätzchen wird in allen möglichen Varianten verwendet katjonak, kotik, katjonatschik, koschytschka, auch kisska (die letzten zwei Formen sind nur für die Frauen).
- Das Häschen (kleiner Hase) sajtschik - manchmal hört man auch: sajtschjonak
- rybka (auch rybathscka und ryban'ka) kommt vom Fisch (ryba). Sonne, aber kein Sonnenschein. Wenn generell eine Tendenz zum Verniedlichen besteht, ist wirklich schwierig zu sagen, welcher Kosename meistverbreitet ist. Hier sind nur ein paar sehr häufige Beispiele:
- ssolnyschka - "Das Sonnchen" (vergleichbar mit dem deutschem Ausdruck: "Sonnenschein", aber "Sonnenschein" werden die Russen nicht genannt)
- lapatschka (oder auch lapuschka und lapan'ka) - das Wort, das man nicht wörtlich in diesem Zusammenhang verstehen darf - (Verkleinerungsform vom lapa - eine Pfote)
Quellen: www.russlandjournal.de und www.russian-online.net
Fußlappen
Fußlappen sind eine Bekleidung des Fußes, die gebräuchlich war, bis Strümpfe allgemein ihre Funktion übernahmen. Es handelt sich um Tücher, die um den Fuß gelegt bzw. gefaltet werden. 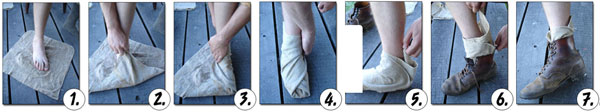
Ein typisches Maß für Fußlappen ist z. B. 40 cm x 80 cm bzw. 40 cm x 40 cm.

In Osteuropa werden sie noch heute z. B. von Bergarbeitern benutzt und - weitgehend - in der russischen Armee. Die Tradition zur Verwendung von Fußlappen wurde von Peter I. bei der holländischen Armee abgeschaut und änderte sich danach über 300 Jahre nicht mehr.
Die Fußlappen sollen keine Naht haben, die reiben und drücken kann, weswegen sie nicht aus mehreren Stücken zusammengenäht sein dürfen und auch nicht an den Rändern umgenäht sind.
Quelle: wikipedia
Bastschuhe

Als Fußbekleidung trug die bäuerliche Bevölkerung selbstgefertigte Bastschuhe, russ. ‚lapti'. Herausragendes Merkmal: die Füße kühlen nicht aus, der Träger hat es warm, bequem und trocken. Wichtig, dass man in ihnen nicht ausrutschen kann. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Wasser einfach wieder abfließt, nachdem man in eine Pfütze hineingetreten ist.
Quelle: nach Diana Siebert, Bäuerliche Alltagsstrategien in er belarussischen SSR. Franz Steiner Verlag 1998
Bastschuhe stellten die meistverbreitete Fußbekleidung im Russland des 18. und 19.Jahrhunderts dar. Das Rohmaterial für die Herstellung der Lapti war nicht schwer aufzufinden: Sie wurden aus der Rinde der Linde, seltener aus der Rinde von Ulmen und Weiden gefertigt. Gekostet haben die Lapti wenig, sie waren bequem und leicht, obwohl sie schnell abgetragen waren. Vor der Herstellung wurde die Rinde in Wasser gelegt, gereinigt und in Streifen von einem Zentimeter Breite geschnitten. Geflochten wurden die Lapti für den linken und rechten Fuß gleich.
Quelle: www.russouvenier.de
Neben den Filzstifeln gelten im Bereich des Schuhwerks die Bastschuhe als Teil der russischen Nationaltracht.
Quelle: www.ervik-eu; www.dreamstime.com
Pud

Das Pud, ist eine russische Gewichtseinheit, entsprechend 40 russischen Funt. Das sind etwa 16.38 kg. Diese Maßeinheit war in Russland, Weißrussland und in der Ukraine gebräuchlich. Urkundlich wurde es zuerst in einer Reihe von Dokumenten aus dem 12. Jahrhundert erwähnt.
Zusammen mit anderen Maßeinheiten für das Gewicht wurde das gesamte System des kaiserlichen Russland offiziell 1924 von der UdSSR abgeschafft. Trotzdem wurde der Begriff bis etwa 1940 weiterhin benutzt. Außer im Sport findet diese Maßeinheit noch für landwirtschaftliche Erzeugnisse Verwendung, etwa für Getreide oder Kartoffeln.
Ein altes russisches Sprichwort sagt: "Du kennst einen Mann erst, wenn du mit ihm zusammen ein Pud Salz gegessen hast."
Quelle: www.wikipedia.de
Werst

Eine Werst war ein Längenmaß im zaristischen Russland.
Eine Russische Meile (russ. Milja) hat 7 Werst, entspricht also 7,4676 km.
Eine Werst entsprach 1066,78 Metern = 500 Saschen (dt. Faden).
1 Saschen = 3 Arschin = 2,1337 m.
Bei der Festlegung bezog man sich auch auf den Breitengrad der Erde am Äquator, so dass es in alten Veröffentlichungen heißt: "104 1/6 Werst gehen auf einen Grad des Äquators". In derselben Quelle gibt es noch eine Umrechnung auf eine Deutsche Meile bzw. eine Geographische Meile, das sind dann "gegen 7 Werst".
1 Arschin = 28 Zoll = 71,12 cm. Quellen: Wikipedia
Taiga
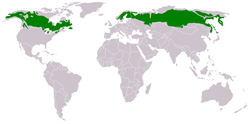
In Nordeurasien ist "Taiga" die Bezeichnung für den borealen Nadelwald, den nördlichsten Waldtypus der Erde. Er entsteht in der kaltgemäßigten Klimazone (daher ausnahmslos auf der Nordhalbkugel); dies ist die nördlichste Vegetationszone, in der das Wachstum von Wäldern möglich ist.
Nördlich der borealen Nadelwaldzone befindet sich die Tundra, im Süden schließen sich kühlgemäßigte sommergrüne Laubwälder oder Waldsteppen an. Das Ökosystem der borealen Nadelwaldzone bildet die größten zusammenhängenden Wälder der Erde.

Die Taiga findet sich in Eurasien: in Nordeuropa, Sibirien, Mongolei. Sie liegt etwa zwischen 50° nördlicher Breite und dem nördlichen Polarkreis. Die boreale Zone beginnt im Süden dort, wo das Klima für Hartholz-Laubbäume zu ungünstig ist, wo also die Sommer zu kurz und die Winter zu lang werden. Hier sinkt die Anzahl der Tage mit Tagesmitteltemperaturen über 10 °C unter 120, und die kalte Jahreszeit dauert länger als sechs Monate. Die nördliche Grenze der borealen Zone liegt dort, wo die Anzahl der Tage mit Tagesmitteltemperaturen über 10 °C unter 30 sinkt.
In der Taiga, die sich als breiter Gürtel durch Sibirien erstreckt, gibt es lange, schneereiche Winter und kurze, ziemlich kühle Sommer. Im Durchschnitt haben weniger als vier Monate über 10 °C. Die kalte Jahreszeit dauert sechs Monate. Die Flora wird durch Nadelwälder gekennzeichnet, die in südlicheren und ozeanisch beeinflussten Gebieten mit Birke und Espe durchsetzt sind.

Die Taiga ist in ihren Kerngebieten oft durch nur eine oder zwei Baumarten bestimmt und zählt daher zu den weniger artenreichen Wäldern. Dies liegt in erster Linie an der kurzen Vegetationsperiode von nur 2 bis 4,5 Monaten. Der Hauptgrund für die Dominanz der immergrünen Nadelbäume ist der Umstand, dass sie bereits am Beginn der Vegetationsperiode über einen voll ausgebauten Photosyntheseapparat in Form von Nadeln verfügen. Ein Schwellenwert ist die Anzahl von mindestens 120 Tagen im Jahr, an denen der Mittelwert der Tagestemperatur 10 °C übersteigt. Die meisten Nadelbäume halten zudem Temperaturen bis zu 40 °C aus. In den Extremgebieten ist es jedoch selbst für die meisten Koniferen zu kalt. In Jakutien sind Temperaturmittelwerte von 50 °C oder noch weniger möglich. Dann tritt die nadelabwerfende Lärche an die Stelle der Fichten und Kiefern.
Zu den Charakterarten zählen nicht nur Bäume, sondern auch Sträucher und Kräuter. Dies sind Heidel- und Preiselbeere, Wald-Wachtelweizen, Siebenstern, Blaue Heckenkirsche, Moosglöckchen, Sprossender Bärlapp und Tannen-Bärlapp, außerdem zahlreiche Moose, die allesamt typisch für einen sauren Boden sind. Der Abbau der ohnehin

schwer zersetzbaren Nadelstreu wird unter den klimatischen Bedingungen dieser Vegetationszone noch weiter verlangsamt. Der Prozess dauert etwa 350 Jahre und läuft damit hundertmal langsamer ab als in mitteleuropäischen Laubwäldern. Die mächtige Humusschicht von bis zu 50 cm hat saure Eigenschaften.
Die Taiga hat einen reichen Vogelbestand von mehr als 300 Arten. Außerdem ist dies der Lebensraum von vielen Säugetieren wie z.B. Elch und Wolf sowie auch Bären. Quellen: Wikipedia
Gurken
Schnelle eingelegte Gurken nach russischer Art - in 3 Tagen fertig
 2 kg frische Gurken), 8-10 cm lang
2 kg frische Gurken), 8-10 cm lang- 3 Dill-Stängel mit Samendolden
- 10 Knoblauchzehen
- 1 Stück Meerrettich, ca. 8 cm lang
- ½ Peperoni
- 5 Johannisbeer-Blätter
- 10 Kirsch-Blätter
- Wasser, gekocht, abgekühlt
- Salz, grobes
Zubereitung
Die Gurken für 3-4 Stunden ins Wasser (normales Leitungswasser) legen, so bleiben sie schön knackig.
Spitzen abschneiden, jede Gurke mit Messer 2-3mal anstechen (1-1,5 cm tief). Dann Dillstangen in ca. 10 cm lange Stücke schneiden, Knoblauchzehen schälen und halbieren, Meerrettich-Wurzel schälen, in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Eine Hälfte von Gewürzen auf den Boden eines großen Glases legen, dann die Gurken, drauf wieder Gewürze.
Für den Sud braucht man für 1 Liter Wasser (gekocht und abgekühlt) 1 Handvoll grobes Salz. Die Gurken mit Sud so aufgießen, dass sie zugedeckt sind, das Glas mit einem Stück Mull zudecken und so stehen lassen.
Bei der Hitze werden diese "Halbsalzgurken" in 2-3 Tage fertig. Dann in den Kühlschrank stellen.
Was am besten dazu schmeckt: Kartoffel schälen, würfeln, kochen, Wasser weggießen, salzen, ein Stück Butter rein und etwas gehackte Petersilie, Deckel drauf und energisch schütteln.
Quelle: www.chefkoch.de
Muschik
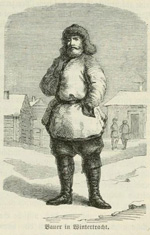
Ein Muschik ist ein einfacher russischer Bauer im zaristischen Russland, der leibeigen war. Das Wort ist abgeleitet von der Verkleinerungsform zu Musch (ausgesprochen mit langem ‚u'), dem russischen Wort für ‚Mann'.
Quelle: www.lexikus.de
Kulak - entkulakisiert

Kulak
Bezeichnung für den russischen Mittel- und Großbauern, aber auch eine abfällige Bezeichnung für die wohlhabenden Bauern auf dem Lande. Kulak, was wörtlich übersetzt "Faust" bedeutet (jemand, der seinen Besitz fest in den Fäusten hält), wird im Sinne von "Wucherer" oder "Dorfkapitalist" gebraucht.
Nach der Oktoberrevolution von 1917 und im Verlauf der Kollektivierungsmaßnahmen (1929/30) unter Stalin wurden der Begriff Kulak zum Schimpfwort und auf alle ländlichen "Ausbeuter" ausgedehnt und als feindliche "Klasse" liquidiert. Auf dem Höhepunkt der Kollektivierung (1932) bedeutete bereits geringfügiges landwirtschaftliches Eigentum, wie zum Beispiel eine Kuh oder die Beschäftigung von Tagelöhnern oder Knechten als Kulakentum und führte zu Zwangsmaßnahmen: Zuerst höhere Abgaben, dann Enteignung, schließlich Deportation in menschenleere Gebiete oder in den Gulag. Oft wurden auch die Familienangehörigen der "Kulaken" und sogar angebliche Kulakensöldlinge verfolgt. Die Kulaken wurden dazu in 3 Kategorien eingeteilt:
Die Bauern der 1. Kategorie galten als "konterrevolutionäre Elemente", die entweder gleich erschossen, oder in ein Arbeitslager der GPU (Staatssicherheitsdienst) gebracht wurden. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt und ihre Angehörigen fielen unter die Deportierten.
Die Kulaken der 2. Kategorie waren zwar weniger gefährlich, galten aber als "fürchterliche Ausbeuter". Sie wurden enteignet, verhaftet und mit ihren Familien in entlegene Gebiete deportiert.
Die Kulaken der 3. Kategorie galten als "staatstreu" und wurden enteignet und in unfruchtbare und unkultivierte Zonen ihrer Distrikte umgesiedelt.

Entkulakisierung
Die Entkulakisierung (russisch raskulatschiwanije) war eine politische Repressionskampagne in der Sowjetunion, die sich während der Diktatur Josef Stalins von 1929 bis 1933 gegen sogenannte Kulaken richtete. Verhaftungen, Enteignungen, Exekutionen und Massendeportationen kennzeichneten diese Politik.
Insbesondere als wohlhabend geltende bäuerliche Familien, aber auch so genannte Mittelbauern samt ihren Angehörigen sowie jene Landbewohner, welche die Politik der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) tatsächlich oder vermeintlich ablehnten, waren Ziel der gewaltsamen Unterdrückung. Rund 30.000 Personen wurden erschossen. Etwa 2,1 Millionen Menschen wurden in entfernte, unwirtliche Regionen deportiert - 1,8 Millionen davon von 1930 bis 1931. Weitere 2 bis 2,5 Millionen Personen wurden in ihrer Heimatregion auf schlechtere Böden zwangsumgesiedelt. Experten schätzen, dass die Entkulakisierung durch Hunger, Krankheiten und Exekutionen 530.000 bis 600.000 Menschenleben kostete. Die Bauern reagierten insbesondere 1930 mit erheblichem Widerstand gegen die Gewaltkampagne des Staates. Zeitweise fürchteten Partei- und Staatsfunktionäre, der bäuerliche Widerstand könne sich zu einem landesweiten Aufstand ausweiten.
Die Entkulakisierung bedrohte die Bauernschaft durch physische Vernichtung, Deportation und Enteignung. Auf diese Weise sollte sie der Zwangskollektivierung zum Durchbruch verhelfen. Im Ergebnis unterwarfen Entkulakisierung und Kollektivierung die gesamte Bauernschaft der staatlichen Kontrolle und trugen wesentlich dazu bei, die tradierte ländliche Sozialverfassung radikal zu verändern. Zugleich legte die Entkulakisierung den Grundstein für die Ausweitung des Gulag-Systems.
Die Kombination von Entkulakisierung, Zwangskollektivierung und weiteren repressiven Maßnahmen führte in vielen Regionen der Sowjetunion, insbesondere in traditionellen agrarischen Überschussregionen, zum Zusammenbruch der Landwirtschaft. Dieser Kollaps war eine der Ursachen für den Holodomor (1932/33), eine epochale Hungerkatastrophe mit etwa fünf bis sieben Millionen Toten.Quellen: Wikipedia und www.migrazioni.altervista.org/deu/3deutsche_in_russland/4.59b_zwischenkriegszeit.html
Prednisolon
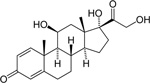
Prednisolon, chemisch 1,2-Dehydrocortisol, ist ein synthetisches Glucocorticoid. 1957 wurde dieser Wirkstoff von der Firma Merck unter dem Namen "Solu-Decortin H" erstmals auf den deutschen Markt gebracht.
In der DDR war die Herstellung der Wirkstoffe Hydrocortison und Prednisolon bei Jenapharm nach einem eigenen Verfahren ab 1961 möglich. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass auch die entsprechenden arzneilichen Zubereitungen (Tabletten usw.) ungefähr ab diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Das erste Korticosteroid wurde aber bereits 1956 produziert, es handelt sich dabei um Doca (Desoxycorticosteronacetat). (Quelle: "Drei Jahrzehnte VEB Jenapharm", Verlag Tribüne Berlin, 1. Auflage)
Prednisolon besitzt eine ausgeprägte immunsuppressive und darüber entzündungshemmende, antiallergische Wirkung. Es wird bei Bronchial- und Lungenkrankheiten wie Asthma bronchiale und Lungengewebserkrankungen unterschiedlicher Ursache verwendet. Kortison ist für die Asthmatherapie unverzichtbar geworden.
Durch Kortison werden Entzündungsreaktionen in den Bronchien unterbunden, und die Schleimproduktion sinkt. Zusätzlich vermindert sich die Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber Reizen, die einen Anfall auslösen können. Kortison ist daher das Dauermedikament jeder Asthmatherapie. Meistens wird das Kortison inhaliert. Nur in schweren Fällen wird es zusätzlich als Tabletten gegeben. Kortison unterdrückt auch die Reaktion bei Allergien, wie z.B. gegen Pollen- und Hausstaub. Quellen: Wikipedia; www.onmeda.de; www.netdoktor.de
Subbotnik
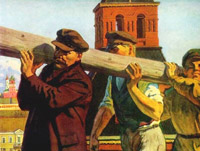
Der Subbotnik (von russisch subbota ‚Sonnabend') ist ein in Sowjetrussland entstandener Begriff für einen freiwilligen, unbezahlten Arbeitseinsatz am Sonnabend. Das Wort "Subbotnik" wurde von Lenin in dem Artikel: "Die große Initiative" (russisch weliki potschin) im Juni 1919 mit dem Untertitel: "Über den Heldenmut der Arbeiter im Hinterland. Anlässlich der "kommunistischen Subbotniks" (russisch O geroisme rabotschich w tylu. Po powodu "kommunistitscheskich subbotnikow") verwendet. Lenin schrieb diesen Artikel, nachdem die Kommunisten und ihre Anhänger bei der Eisenbahn Moskau-Kasan im Jahre 1919 beschlossen hatten, solche "kommunistischen Subbotniks" zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der Wirtschaft durchzuführen.
Manjeshnaja

Manjeshnaja ist eine Strasse und ein Platz in Moskau im Rücken des Kreml. Auf dem Platz ist heute ein Reiterstandbild des Berlin-Eroberers General Georgi Schukow und ein Märchenskulpturenpark des Bildhauers Surab Zereteli. Unter dem Platz liegt - mit mehreren Glaskuppeln zum Platz - ein Einkaufszentrum.
Lubjanka

Die Lubjanka ist der inoffizielle Name eines am gleichnamigen Platz in Moskau gelegenen Gebäudes. Von 1920 bis 1991 war es das Hauptquartier, das zentrale Gefängnis und das Archiv des sowjetischen Geheimdienstes in Moskau. Heute beherbergt die Lubjanka den russischen Geheimdienst FSB.
RIAS

Da die westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges erst drei Monate später als die Rote Armee in Berlin eintrafen, hatte sich die sowjetische Besatzungsmacht bereits des Rundfunks in Berlin bemächtigt und im Haus des Rundfunks in der Charlottenburger Masurenallee den Berliner Rundfunk installiert. Die Schlüsselfunktionen hatten sie mit moskautreuen Deutschen besetzt. Nachdem die westlichen Besatzungsmächte vergeblich in der Alliierten Kommandantur der vier Besatzungsmächte eigene Sendezeiten im Berliner Rundfunk eingefordert hatten und es ihnen auch nicht gelang, den Sender unter eine Vier-Mächte-Kontrolle zu stellen, unternahmen die Amerikaner und Briten Vorkehrungen, selbständige Rundfunkstationen in ihren Sektoren einzurichten.
Von Beginn an war der RIAS mit seiner Programmgestaltung innovativ und wirkte als Vorbild für die westdeutsche Rundfunkszene. Die Programme des Senders standen unter dem selbst gewählten Motto "Eine freie Stimme der freien Welt".
"Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt."

Beispielgebend war der RIAS zum Beispiel auf dem Kultur- und Unterhaltungssektor. Der RIAS ist auch als Erfinder der Hitparade im deutschen Rundfunk anzusehen. Bevor diese 1958 von Radio Luxemburg gestartet wurde, hatte der RIAS schon 1949 die wöchentlichen "Schlager der Woche" in seinem Programm. Nach dem Berliner Mauerbau überwand der RIAS die trennende Grenze über den Äther mit seiner sonntäglichen Grußsendung "Musik kennt keine Grenzen".
Am 6. Juli 1948 wurde das neue Funkhaus in der Kufsteiner Straße 69 eingeweiht. Nach dem Einsatz eines Kurzwellensenders, der "Stimme Amerikas" in München-Ismaning ab 6. Juli 1948, und der Verbesserungen der Antennenanlagen in Britz wurde mit der Inbetriebnahme eines 20-kW-Mittelwellensenders im oberfränkischen Hof am 1. November 1948 deutlich, dass das Verbreitungsgebiet des RIAS über Berlin hinaus auf das Gebiet der sowjetischen Besatzungszone ausgedehnt werden sollte. Da der Sender von Anfang an ein von den USA geprägtes Meinungsbild vertrat, wurde er von den Machthabern der 1949 gegründeten DDR schnell als Feindbild ausgemacht. So erklärte das Oberste Gericht der DDR am 27. Juni 1955 den RIAS zu einer Spionage-, Sabotage- und Verbrecher-Organisation. Schon vorher hatte man begonnen, das gesamte DDR-Gebiet mit einem Netz von Störsendern zu überziehen. Das wiederum veranlasste den RIAS zu einer immensen technischen Aufrüstung.
Quelle: www.wikipedia.de
Berliner Freiheitsglocke mit Schwur: vom Rathaus Schöneberg immer am Sonntag um 12 Uhr
Nowodewitschi

Der Nowodewitschi-Friedhof (zu Deutsch „Neujungfrauen-Friedhof“) ist einer der bekanntesten Ehrenfriedhöfe in Russland. Er liegt am südwestlichen Ende des Zentralen Verwaltungsbezirks von Moskau am linken Ufer der Moskwa. Seinen Namen verdankt er dem zum UNESCO-Welterbe zählenden Nowodewitschi-Kloster, vor dessen Mauern er liegt.
Quelle: www.wikipedia.org
ZfG

Die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (kurz ZfG) ist eine monatlich erscheinende deutschsprachige geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift. Die ZfG wurde 1953 in der DDR begründet. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 löste sie sich von ihrer marxistischen Ausrichtung.
In der DDR hatten die Geschichtswissenschaften eine „zentrale politische und ideologisch bedeutsame Stellung“ inne. Sie sollten die Menschen im Osten Deutschlands „im Geist des sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationalismus [mit der Aufgabe] der Herausbildung eines eigenen nationalen Bewusstseins“ erziehen.
Quelle: www.wikipedia.org, www.metropol-verlag.de
Broiler

Broiler (engl. broil braten, grillen) war eine insbesondere in der DDR übliche Bezeichnung für Brathähnchen oder Brathuhn, die auch heute besonders in Ostdeutschland noch sehr häufig verwendet wird. Der Begriff angloamerikanischen Ursprungs wird in der Fachsprache der Geflügelzüchter aller deutschsprachigen Länder verwendet und bedeutet dort "zur Mast bestimmtes Hähnchen". Broiler wurde in der DDR 1961 zum Gattungsnamen für Brathähnchen, als dort "Broiler" aus einer bulgarischen Geflügelzüchterei verkauft wurden. Diese hatte ihnen in Anlehnung an das englische "broil" den Markennamen "brojleri" gegeben (der bulgarische Name für solches Geflügel ist Pile, "Hühnchen"). Seither besitzt das Wort im Deutschen wie im Angloamerikanischen beide Bedeutungen, sowohl für das Masthuhn in der Geflügelzucht wie für das Huhn als Lebensmittel.
Nach neuen Sprachforschungen kam der Name Broiler vermutlich folgendermaßen in die DDR: Züchter aus den Ostblockstaaten, allen voran der Sowjetunion, wollten ein besonders fleischreiches Brathuhn züchten, was allerdings nur in bescheidenem Umfang gelang. In den 1950er Jahren hat allerdings eine Bremer Firma ein solches fleischreiches Huhn aus mehreren alten deutschen Rassen gezüchtet und an eine amerikanische Geflügelfirma verkauft. Ob der Name Broiler bereits als Markenname von der deutschen oder erst von der amerikanischen Firma verwendet wurde, ist nicht genau bekannt.
Es ist lediglich gesichert, dass über diese amerikanische Firma der Ausdruck broiler in die DDR kam. Der Grund war der oben angeführte gescheiterte Versuch, das fleischreiche Brathuhn zu züchten. Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe beschloss daher Ende der 1950er Jahre, die Hühnerrasse von der amerikanischen Firma zu importieren. Dies sollte allerdings, vermutlich aus politischen Gründen, über Bulgarien geschehen. Auf diese Weise verbreitete sich der Broiler dann im Ostblock.
Andere Quellen gehen davon aus, dass die Broilerzucht in den 1960er Jahren in einer bulgarischen Stadt Tolbuchin entwickelt wurde. Dort gelang erstmals die industrielle Massenzucht von Masthähnchen in zehn Wochen zu einem Gewicht von etwa 1,5 kg. Zur besseren Vermarktung im Ausland benutzte man für die Neuzüchtung den an das Amerikanische angelehnten Namen "brojleri".

In der DDR wurde zu Werbezwecken auch die Bezeichnung Goldbroiler verwendet. Daraus leitete der Volksmund die Begriffe Silberbroiler oder Bronzebroiler ab, womit dann auf eine minderwertig Qualität angespielt wird. Laut DDR-Duden wiegen Broiler nach acht bis zehn Wochen 1,2 bis 1,4 kg, die bulgarischen Masthähnchen in den 1960er Jahren wogen nach zehn Wochen Aufzucht rund 1,5 Kilogramm. (Quelle: wikipedia)
Broiler Rezept nach Kurt Drummer, dem beliebten Fernsehkoch der DDR
1 Hähnchen (Broiler), Salz und Pfeffer, Paprikapulver, Zitrone(n), 1 Bund Petersilie, 3 Zwiebel(n), 2 EL Öl, 250 ml Apfelsaft, 3 Paprika mariniert, 250 ml Milch gesäuert, 1 Apfel, 1 EL Mehl
Zubereitung
Den gut gewaschenen Broiler in 8 Stücke zerteilen (je 4 Brust- und Keulenstücke), in eine Schüssel legen, mit Salz, Pfeffer und 1 Esslöffel Paprika würzen, mit dem Saft der Zitrone beträufeln, die gehackte Petersilie, eine in dünne Scheiben geschnittene Zwiebel und I 1/2 Esslöffel Öl untermischen. Die Schüssel zudecken und das Broilerfleisch 24 Stunden kühl gestellt marinieren lassen.
Etwa 45 Minuten vor dem Essen das restliche Öl in einer Pfanne erhitzen, die abgetropften Broilerstücke anbraten, die restlichen, in Scheiben geschnittenen Zwiebeln zufügen und 1 Esslöffel Paprika darüber streuen. Nach und nach mit dem Apfelsaft ablöschen, das Gericht zugedeckt fast gar werden lassen. Kurz bevor das Fleisch weich ist, die in Streifen geschnittenen Paprikafrüchte zugeben und alles völlig garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, zuletzt den würzigen Bratensaft mit einer Mischung aus Milch, geriebenem Apfel und Mehl binden. (Quelle: www.chefkoch.de)
Sprelacart

Sprelacart ist der DDR-Markenname für spezielle mit Kunstharz gebundene Schichtstoffplatten. Das Herstellungsverfahren dafür wurde 1919 in den Römmler-Werken in Spremberg entwickelt und das Produkt 1930 Resopal getauft. Als die Römmler-Werke in Spremberg im Zuge der Reparationsleistungen an die Sowjetunion demontiert wurden, gründeten einige Mitarbeiter im hessischen Groß-Umstadt ein neues Unternehmen, das bald wieder „Resopal“ produzierte. Kriegsheimkehrer bauten auch in Spremberg wieder ein Werk auf. Ihr Produkt, identisch mit dem westlichen, hieß seit 1955 Sprelacart - zusammengesetzt aus Spremberg, Laminat und Carton.
Ein Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck zusammengefügt werden. Meistens wird die oberste Papierschicht (Finishfilm) mit einem Motiv (von Holz über Metallic bis hin zu Marmor) versehen. Sie ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Diese Schichtstoffplatten bilden die Basis für Arbeitsplatten, Fensterbänke und Forming-Elemente.
Bekannt ist Sprelacart vor allem durch die in der DDR gefertigten Küchenmöbel und Schrankwände, die eine leichte und hygienische Reinigung der Oberflächen ermöglichte. Besonders in den Küchen-Zellen der Plattenbauten aus den 1950er bis 1970er Jahren wurden Einbaumöbel mit dieser Beschichtung eingesetzt.
Quelle: www.wikipedia.de
Schlange stehen vor der Gaststätte

Der Besuch einer Gaststätte forderte vom Kunden meist viel Zeit und Anpassungsfähigkeit. Grundsätzlich musste der Gast damit rechnen, in einer langen Schlange vor dem Restaurant darauf zu warten, eingelassen zu werden. War er endlich vorgerückt, durfte das Lokal nicht selbständig betreten werden. Ein Kellner gestattete den Eintritt und platzierte den Gast. Dabei wählte der Kellner den Tisch aus. Da der Gast bereits lange anstehen musste, um eingelassen zu werden, unterließ er jede Diskussion über Sitzplatzvorlieben. Schließlich hatte er zu befürchten, in der Folge besonders lange auf sein Gericht warten zu müssen.
Die Auswahl der Speise erforderte einen flexiblen Appetit, denn eine große Auswahl an Gerichten gab es nicht. Hatte der Gast schließlich gewählt, hieß es oft seitens des Kellners, das Gericht sei nicht mehr vorrätig. Deshalb erhielt der Kunde häufig eine Speisekarte, auf der mehrere ausverkaufte Gerichte bereits gestrichen waren. Die unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln hatte eine staatlich voraus geplante, schlechte Belieferung der Restaurants zur Ursache, die nicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste reagieren konnte. (Quelle: http://www.ddr-geschichte.de/GESELLSCHAFT/Gastronomie/gastronomie.php)
Parteilehrjahr

Das Parteilehrjahr ist ein Begriff aus der politischen Bildung der DDR: es fand seit 1950 (auf Beschluss des III. Parteitages) regelmäßig statt und wurde bis 1989 durchgeführt. Vorläufer waren die seit 1946 organisierten politischen Bildungsabende. Das Parteilehrjahr entsprach der Schulungsform der KPdSU und diente der Massenschulung, wobei die marxistisch-leninistische Schulung einen Schwerpunkt bildete. In den fast 80000 Grundorganisationen wurde das Parteilehrjahr monatlich nach einem einheitlichen Plan mit Vorträgen in Seminaren und Studienkursen veranstaltet.
Der Themenplan orientierte sich an den Beschlüssen der Parteitage und wurde seit den 1960-er Jahren vom Politbüro oder Sekretariat beschlossen. Die Teilnehmer und Propagandisten erhielten dafür extra gedruckte Lehrmaterialien und Studieneinführungen. Mitglieder und Kandidaten der SED waren verpflichtet das Parteilehrjahr zu besuchen. Aber auch Parteilose, wie Lehrer und Bedienstete des Staatsapparates, mussten unabhängig von ihrer politischen Bindung am Parteilehrjahr teilnehmen. (Quelle: Archivgut der SED und des FDGB - Glossar www.bundesarchiv.de/sed-fdgb-netzwerk/glossar.html?q=Parteilehrjahr)
Der Spiegel wusste in seiner Ausgabe 43/1951 über den Beginn dieser Schulungsroutine der SED zu berichten:
"Das zweite Parteilehrjahr der SED hat gerade begonnen und soll nach den Beschlüssen des Politbüros vom 7. August "auch möglichst vielen Parteilosen die Erkenntnis der Größe des Führers der gesamten fortschrittlichen Menschheit, des Genossen Stalin, vermitteln." Diese Aufgabe hatte schon Parteilehrjahr Nr. 1, das vor einigen Wochen ferienlos ablief.
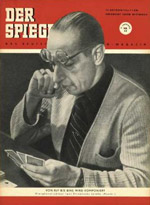
Aber der oberste Schulungschef, Politbüro-Mitglied Fred Oelssner (48), der vor 1945 mehrere Polit-Akademien in Moskau absolvierte, ist mit dem bisherigen Ergebnis gar nicht zufrieden. Die gewünschte "Bewußtseinsänderung" dringt nur mangelhaft durch. Die meisten der älteren Schulgänger auf den politischen Erwachsenen-Schulen (die für jeden "volkseigenen" Betrieb und für jede Behörde in der Ostzonenrepublik so selbstverständlich sind, wie Bilder von Josef Wissarionowitsch Stalin und Wilhelm Pieck) waren nach Oelssners Inspektionstest nicht versetzungsreif und müssen noch ein Jahr lang nach Feierabend oder in den Betriebsschulungsstunden die politische Klippschul-Bank drücken.
Oelssner kritisch im SED-Zentralorgan "Neues Deutschland": "Nur etwa 60 Prozent der anfänglich gemeldeten eine Million Parteimitglieder und 70 000 Parteilosen nahmen bis zum Schluß an den Schulungszirkeln teil." Die anderen schwänzten, wo sie nur konnten. So rollt nun das ganze Lehrjahr mit erweitertem Lehrplan noch einmal an. Das Schulsystem ist streng gegliedert in:
- Politische Grundschule (für Parteilose, Parteikandidaten und unbedarfte Genossen, die von den verzwickten theoretischen Windungen des Leninismus-Stalinismus keine Ahnung haben.)
- Kreisabendschulen für Fortgeschrittene (mittlere Parteidienstgrade).
- Abenduniversitäten für die gehobenen Funktionäre mit Sonderfakultäten zur Befruchtung von Künstlern und Schriftstellern mit "marxistisch-leninistischer Aesthetik."
- Fernhochschulen, hauptsächlich für leitende Staatsfunktionäre in der Provinz. Sie bekommen ihre Schulungs- und Prüfungsaufgaben direkt von Fred Oelssner und der obersten Schulaufsichtsbehörde, der "Parteihochschule Karl Marx" in Klein-Machnow, wo alle Spitzenfunktionäre ein Jahr lang wie in einer Kaserne Tag für Tag ideologisch geschliffen werden.
Quelle: Der Spiegel
Politische Witze
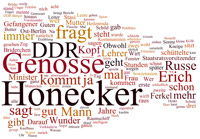
Ein politischer Witz ist ein sehr kurzer Text (Kürzestdialog, Scherzfrage u. ä.), welcher aktuelle Zustände oder Ereignisse der Politik dem Gelächter preisgeben will.
Flüsterwitze in der DDR
Die Unfreiheiten in der DDR ließen dem Bürger einzig den Witz als Möglichkeit des politischen Protestes. In den ersten Jahren dominierten hierbei u.a. die Themen Antikommunismus, Antistalinismus, Mangelwirtschaft, Reparationen, Verbot der freien Meinungsäußerung. So war es üblich, die Witze im Flüsterton und unter vorgehaltener Hand weiterzugeben. Schließlich konnten politische Witze gerade in den Anfangsjahren der DDR als "Antisowjethetze" oder "Sabotage des sozialistischen Aufbaus" ausgelegt und mit Zuchthausstrafen belegt werden. Diese erste Phase des politischen Witzes in der DDR dauerte bis zum Bau der Berliner Mauer, der zwar die Unfreiheit erhöhte, aber dennoch den DDR-Staat stabilisierte.
Mit der zunehmenden Entspannungspolitik besänftigte sich auch der politische Witz und infolgedessen auch die verhängten Strafen. Der Staat bemühte sich sogar mit der Satirezeitschrift Eulenspiegel einen "amtlich geförderten Witz" zu installieren. Da dabei aber nur Randerscheinungen der innerstaatlichen Probleme angesprochen wurden, existierte weiterhin der freie Witz, der auch die Tabus Regierung, Partei, Militär, Unfreiheit und Staatsgrenze nicht ausließ. Das Kabarett in der DDR hatte wiederum genau diese Tabus zu beachten. Der offizielle Humor in der DDR stand unter der steten Kontrolle von Kulturfunktionären, die ein Programm vor Veröffentlichung abnehmen mussten. So lernte das Publikum mit den Jahren "zwischen den Zeilen zu lesen". Letztlich war der Witz in der DDR eine Reaktion auf den Widerspruch zwischen Idee und Wirklichkeit eines sozialistischen Staatswesens. Und so war der politische Witz und auch die Repression in der DDR stärker ausgeprägt als in der Bundesrepublik Deutschland. (Quelle: wikipedia, morgenpost.de)
Wolga

Wolga ist eine bis 2010 produzierte russische, vormals sowjetische Automarke. Der Wolga wurde von der russischen Automobilfabrik GAS (engl. Transkription Gorkovsky Avtomobilny Zavod (GAZ)), deutsch: Gorkier Automobilwerk) hergestellt.
Dieses Werk befindet sich im zentralrussischen Nischni Nowgorod (1932 bis 1990 Gorki) und produziert seit 1932 Automobile. Der GAZ M-21 löste 1956 den GAZ M-20 Pobeda ab und wurde bis 1968 produziert. Er war der erste Wagen mit dem Namen Wolga. Die zum Teil vom Pobeda übernommene technische Ausstattung (z.B. die 3-Gang-Schaltung) waren veraltet, in den späten 1960ern auch das Design des GAZ-21.

Der Kraftstoffverbrauch des GAZ-21 war auch schon für damalige Verhältnisse enorm und stand in keinerlei Verhältnis zu den Fahrleistungen. In der Sowjetunion spielte dies jedoch eine untergeordnete Rolle, da Benzin billig war und der Wolga fast jede gebotene Spritqualität annahm und verarbeitete. In den osteuropäischen Staaten galt der Wolga zwar als Oberklassemodell, hatte jedoch nicht den Stellenwert eines Nobelautos. In der UdSSR wurde der Wolga meist als Behördenfahrzeug oder Taxi benutzt, wie auch in der früheren DDR.
Quelle: www.wikipedia.de
Pobeda

Pobeda (russisch für Sieg) war ein sowjetischer PKW der Mittelklasse, hergestellt in der GAZ-Fabrik (Molotow-Werke) nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Typenbezeichnung M-20 mit elegant abfallendem Heck und einem SV-Vierzylindermotor.Er zeichnete sich durch Robustheit aus, mit Ausnahme der Ventile.
Das Design folgte dem Zeitgeschmack der 1940er Jahre und ähnelt stark dem Chevrolet Fleetline Aerosedan. Bei der Projektierung des Chassis und der Antriebskomponenten orientierten sich die sowjetischen Ingenieure am 1939er Opel Kapitän. Dieser wurde zur damaligen Zeit als einer der technisch fortschrittlichsten PKW angesehen.
Anfangs lief die Entwicklung unter der Projektbezeichnung GAZ M-25 mit dem Arbeitstitel "Rodina" (Heimat), später folgte dann der Wechsel zur Modellnummer 20. Die Serienproduktion begann am 28. Juni 1946, der Name des Autos wurde angesichts des Ausganges des 2. Weltkrieges von "Rodina" auf "Pobeda" geändert.
Noch nie zuvor war in der Sowjetunion ein Auto in derart hohen Stückzahlen produziert worden. Seit 1951 wurde an einem Nachfolger des Pobeda gearbeitet - Arbeitstitel GAZ M-21 - Pobeda II. Die Bezeichnung des Projektes wurde später in "Swesda" (Stern) und anschließend in "Wolga" geändert. Dessen Produktion begann im Jahre 1956, der Pobeda wurde parallel bis 1958 gefertigt. Es entstanden 235.997 Exemplare.
Quelle: wikipedia
Weltzeituhr

Der Alexanderplatz ist ein zentraler Platz und Verkehrsknotenpunkt in Berlin. Er liegt im Ortsteil Mitte in der früheren Königsstadt und wird im Volksmund kurz Alex genannt. Er wurde nach dem russischen Zaren Alexander I. benannt.
Im Jahr 1966 hatte eine Verkehrszählung ergeben, dass in Spitzenzeiten 10.000 Personen die Stationen der U- und S-Bahn am Alexanderplatz nutzten, rund 7.000 Menschen überquerten die Fahrdämme, unzählige Omnibusse und Straßenbahnen querten das Oval. Im März 1966 begann die Umsetzung der Neubauplanung des Alexanderplatzes auf der Grundlage des Architekturwettbewerbs. Im darauffolgenden Jahr wurden alle Straßenbahn-Linien vom Platz entfernt und anderweitig geführt.
Auf der nordwestlichen Platzseite entstanden bis 1969 das Centrum-Warenhaus und das 120 Meter hohe Interhotel ‚Stadt Berlin'. In der gleichen Zeit wurde auf der Nordseite das Haus des Berliner Verlages, das zehngeschossige Haus der Elektroindustrie sowie 1970 das Haus der Statistik und 1971 das siebzehngeschossige Haus des Reisens errichtet. 1969 wurde der gesamte Platz neu gestaltet. Walter Womackas Brunnen der Völkerfreundschaft und Erich JohnsUrania-Weltzeituhr schmückten nun die Platzfläche. Sie wurden schon bald zu beliebten Treffpunkten der Berliner und Touristen. Damit war die bauliche Fassung und Umgestaltung des Alexanderplatzes im Sinne einer sozialistischen Stadtplanung fertiggestellt.
Quelle: www.wikipedia.de
Selbstbedienungsgaststätte am Alexanderplatz

Das Automatenrestaurant ist ein Selbstbedienungsrestaurant mit Sitzplätzen, in dem alle Gerichte und Getränke in Verkaufsautomaten bereitgehalten werden, die mit einem Münzeinwurf versehen sind, so dass die Kunden im Restaurant keinerlei Kontakt zu Servicepersonal haben. Das weltweit erste Schnellrestaurant dieser Art wurde 1896 von Ludwig Stollwerck in der Leipziger Straße in Berlin eröffnet. Es war von der Deutsche Automaten Gesellschaft Stollwerck & Co. eingerichtet worden, die Ludwig Stollwerck gemeinsam mit den Erfindern Max Sielaff und Theodor Bergmann 1895 gegründet hatte. Ludwig Stollwerck und Max Sielaff hatten einen "Automatenpavillon" schon 1886 auf der Internationalen Gewerbeausstellung ausgestellt. Andere Städte mit "Automatischen Buffets" folgten, vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland rund 50 Automatenrestaurants.
Quelle: www.wikipedia.de
Interhotel am Alexanderplatz


Im Zuge des Umbaus des Alexanderplatzes zum neuen Zentrum Ostberlins Ende der 1960er Jahre entstanden rings um den Platz einige Bauten, die sein Gesicht bis heute prägen.
Das Interhotel "Stadt Berlin"
Der 24. Juni 1967 ist in Bezug auf das Hotel erwähnenswert, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch kein einziger Handschlag zu seiner Errichtung getan ist. Denn an diesem Tag wird am späteren Standort des Hotels der Grundstein für den neuen Alexanderplatz, das neue Zentrum der Hauptstadt der DDR, gelegt. Wenig später beginnen dann auch die Bauarbeiten für den monumentalen Hochhausbau, die im Jahre 1970 schließlich abgeschlossen werden. Stolze 123 Meter hoch, überragt der neue Bau mit seinen 37 Etagen sämtliche Gebäude der Stadt, sieht man einmal vom Fernsehturm ab. Er ist damit das höchste bewohnte Gebäude Berlins - und das auch noch heute.
Das nach Entwürfen der Architekten Roland Korn, Heinz Scharlipp und Hans-Erich Bogatzky errichtete Hotel erhält den Namen Interhotel "Stadt Berlin". Es bietet insgesamt auf insgesamt dreißig Hoteletagen mit je 34 Zimmern Platz für zweitausend Gäste, verfügt über eine finnische Sauna und elf Restaurants, deren größtes 1600 Gästen Platz bietet. Bis auf den heutigen Tag ist es das größte Berliner Hotel und das drittgrößte Deutschlands. (Quelle: Bundesarchiv; Alexander Glintschert (1997); www.anderes-berlin.de)
Centrum Warenhaus


Centrum war eine Warenhauskette und Tochtergesellschaft der Handelsorganisation der DDR. Die Warenhäuser befanden sich in Ober- und Mittelzentren der DDR und waren zumeist größer als die Konsument Kaufhäuser der Konsum-Genossenschaft. Fast alle während des Bestehens der DDR errichteten Gebäude hatten als Corporate Design eine ornamentierte Metallfassade.
Ab Juni 1968 begann die Errichtung des ersten Warenhausneubaus in Montagebauweise der DDR. Ab 1970 wurde eine Reihe von Neubauten im Stil der Klassischen Moderne geplant, z. B. in Berlin am Alexanderplatz.

Die experimentellen Metallfassaden stellten ein Corporate-Design-Element der Kette dar, waren aber individuell für jeden Bau gestaltet. Die Metallfassaden stehen nicht unter Denkmalschutz und wurden häufig von den neuen Eigentümern der Häuser ersetzt (Kaufhof, Berlin-Alexanderplatz).
RFB

Der Rote Frontkämpferbund (RFB) war die paramilitärische Schutztruppe der KPD in der Weimarer Republik. Er wurde Mitte Juli 1924 in Thüringen gegründet (es werden unterschiedliche Daten kolportiert) und entwickelte eine Agitationskultur, die von einem Frontkämpferdasein ebenso geprägt war wie von ihrem politischen Selbstverständnis. Am 3. Mai 1929 wurde der RFB vom preußischen Innenminister verboten. Seine Mitglieder agierten in Nachfolgeorganisationen oder wechselten die politische Heimat.Quelle: wikipedia
Interhotel

Interhotel war eine am 1. Januar 1965 gegründete Hotelkette in der DDR. Interhotels waren Hotels der gehobenen Klasse, in denen bevorzugt Gäste aus "nichtsozialistischen Wirtschaftsgebieten" (NSW) untergebracht wurden.
Ursprünglich bestand die Hotelkette aus je einem Hotel in Berlin, Erfurt, Jena und Magdeburg, zwei Hotels im damaligen Karl-Marx-Stadt und fünf Hotels in Leipzig. Die Fünf-Sterne-Häuser standen nahezu ausschließlich Besuchern aus dem "nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet" offen, die Bezahlung hatte für sie in Devisen zu erfolgen. In Vier-Sterne-Häusern wurden oft Gäste aus dem Bereich des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe untergebracht. Ein bekanntes Beispiel ist das Hotel Stadt Berlin in Ost-Berlin, das vor allem als Hotel für sowjetische Gäste galt. Die niedrigste Stufe von Interhotels waren einige Drei-Sterne-Häuser, vor allem in kleineren Städten, wie beispielsweise das Hotel Elephant in Weimar.
Interhotels standen unter der Kontrolle der Hauptabteilung VI des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), Abteilung Touristik. Das MfS versuchte, sowohl die Aktivitäten internationaler Gäste zu überwachen als auch nachrichtendienstlich zu nutzen. Oft wurden kompromittierende Situationen konstruiert (Einsatz von als IM verpflichteten Prostituierten in audio- und videoüberwachten Hotelzimmern), um den Betroffenen zur Mitarbeit zu "bewegen". Aufgrund der Kontaktmöglichkeiten mit Reisenden aus dem kapitalistischen Ausland war auch der IM-Prozentsatz der Hotelbelegschaft überproportional hoch. (Quelle: wikipedia; www.akpool.de/ansichtskarten/235369-foto-ak-p...)
Erinnerungen an das Exil in der UdSSR
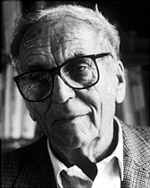
Die an dieser Stelle im Roman angesprochenen Erinnerungen, Kurts Absicht, über sein Exil in der Sowjetunion zu schreiben, gibt es tatsächlich: Anfang 2012 erschien bei Rowohlt die Autobiographie von Wolfgang Ruge, Vater des Romanautors Eugen Ruge, unter dem Titel "Gelobtes Land. Meine Jahre in Stalins Sowjetunion".
Wolfgang Ruge (1917-2006) wurde von seinen Eltern schon als Kind im Sinne des Kommunismus erzogen. Sein Bruder wurde in der Sowjetunion verhaftet, sein ebenfalls emigrierter Vater an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Ruge selbst verbrachte vier Jahre im stalinistischen Lager und elf in der Verbannung. Nach seiner Ausreise in die DDR arbeitete er bis 1982 als Professor im Fachbereich Weimarer Republik an der Akademie der Wissenschaften. Er galt als einer der bedeutendsten Historiker der DDR. (Quelle: Rowohlt Verlag)
Stalins Tod

Die offizielle Version von Stalins Tod besagt, dass der Diktator am 5. März 1953 an den Folgen eines Schlaganfalls starb.
Am Abend des 28. Februar 1953 traf sich Stalin mit Lawrenti Beria, Georgi Malenkow, Nikolai Bulganin und Nikita Chruschtschow zum Abendessen auf seiner Datscha in Kunzewo. Die Unterredung, gegen deren Ende Stalin in einem langen Monolog seine Mitarbeiter heftig kritisierte, dauerte bis vier Uhr am Morgen des 1. März 1953. Nach der Verabschiedung seiner Gäste erlitt Stalin in seinem Zimmer unbemerkt einen Schlaganfall.
Erst um 23 Uhr wagte sich der diensthabende Mitarbeiter M. Starostin zu Stalin, den er in Pyjamahose und Unterhemd auf dem Fußboden liegend fand. Stalin war bei Bewusstsein, konnte aber nicht sprechen. Die Bediensteten legten ihn auf den Diwan, wo er das Bewusstsein verlor. Zunächst erschien Malenkow, dann um drei Uhr morgens am 2. März Beria. Dieser verbot den Leibwachen und Hausbediensteten zu telefonieren und entfernte sich mit Malenkow. Um neun Uhr kamen Beria und Malenkow in Begleitung von Chruschtschow zurück, etwas später erschienen weitere Politbüromitglieder und Ärzte.
Einige Stunden später wurde eine Regierungsmitteilung veröffentlicht, in der mitgeteilt wurde, dass Stalin Gehirnblutungen erlitten hatte, die lebenswichtige Teile des Gehirns erfassten. Am 5. März 1953 um 9 Uhr 50 verstarb Stalin im Alter von 74 Jahren. (Quelle: wikipedia.de; dhm.de)
Neben dieser Überlieferung gab es immer wieder Auffassungen, nach denen Stalin vergiftet wurde. Laut den Memoiren von Wjatscheslaw Molotow, die 1993 veröffentlicht wurden, hat Beria ihm gegenüber behauptet, dass er Stalin vergiftet habe. Auch einige der angesehensten und bekanntesten Mediziner der UdSSR wurden in den Monaten vor seinem Tod beschuldigt, an einer Ärzteverschwörung beteiligt zu sein, die sich zum Ziel gesetzt hätte, die oberste sowjetische Politik- und Militärführung zu vergiften. Nach Stalins Tod erwies sich diese Verdächtigung als haltlos.
Diese Ärzteverschwörung ( "Ärzte als Saboteure", oder "Ärzte als Mörder") war eine angebliche Verschwörung von Medizinern vor allem jüdischer Herkunft, um die Führung der Sowjetunion um Josef Stalin auszuschalten. Sie führte zu zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen. Zu Beginn der Entstalinisierung nach Stalins Tod im März 1953 gaben die neuen Sowjetführer zu, dass es sich um eine vorgeschobene, von Stalin und einigen Gefolgsleuten fabrizierte Verdächtigung gehandelt hatte. (Quelle: wikipedia)
Auch im internet kursieren verschiedene Darstellungen, so etwa die Interpretation, dass Stalin vergiftet wurde, um den dritten Weltkrieg zu verhindern. Aus dem Jahre 2003 stammt ein Beitrag der BBC, dem entsprechend Stalin möglicherweise getötet wurde, weil er im Begriff war, die schwache Sowjetunion in den dritten Weltkrieg zu führen. Der russische Historiker Radzinski glaubt an Mord und liefert Informationen.
In der Nacht des 28. Februars 1953 erteilte der Hauptwachmann Stalins Khrustalev den ungewöhnlichen Befehl, dass alle Wachen schlafen gehen sollten. Angeblich habe der damalige KGB-Chef Lavrenty Beria (Foto oben rechts) dem Hauptwachmann befohlen, Stalin tödliches Gift zu spritzen. (Quelle: www.cosmiq.de/qa/show/857134/wann-und-wie-starb-josef-stalin/)
Auch der britische Historiker Simon Sebag Montefiore geht in seinem 2003 erschienenen Buch "Stalin: The Court of The Red Tsar" auf eine Überlieferung ein, nach der Zhenia, die Schwägerin Stalins, sich geweigert habe, als Haushälterin für ihn zu arbeiten, aus Furcht, Beria würde ihr anhängen, Stalin vergiften zu wollen, wenn sie erst mal mit im Haus wohnte. (Quelle: Die Welt 03.08.2003)
Der kleine Trompeter

Der Kleine Trompeter ist ein sentimentales politisches Lied der Zwischenkriegszeit. Das Lied wurde nach dem Krieg in der DDR gepflegt, gehörte aber auch zum Repertoire westdeutscher Liedermacher wie Hannes Wader.
Das Lied behandelt in der 1925 entstanden Fassung das Schicksal des 1897 geborenen Hallenser Bürstenbinders Friedrich August Weineck, besser bekannt als Fritz Weineck. Dieser war ab 1924 Mitglied im Roten Frontkämpferbund (RFB), einem paramilitärischen Kampfverband der KPD.
Weineck gehörte als Hornist einem Spielmannszug des RFB an und starb bei Unruhen am 13. März 1925 durch den Schuss eines Polizisten. Weinecks Tod wurde von der KPD propagandistisch verwertet, was zur Entstehung des Liedes von 1925 führte, welches weite Verbreitung fand.
Die Melodie wurde von dem Soldatenlied ‚Von allen Kameraden' übernommen, der Textdichter ist unbekannt. Nach Zeitzeugenberichten sind die Verse "aus dem Volke gekommen".
Die Fassung von 1925 - nach dem Tod von Fritz Weineck - bestand aus fünf Strophen:
|
Von all' unsern Kameraden Wir saßen so fröhlich beisammen Da kam eine feindliche Kugel |
Da nahmen wir Hacke und Spaten Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, MP3-Quelle: www.kampflieder.de |
In der DDR wurde das Lied vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) um eine Strophe verlängert: Du bist nicht vergeblich gefallen, |
Der Text der neuen 6. Strophe ist länger, da die jeweils zweite Hälfte der Originalstrophen wiederholt werden, während die angehängte Strophe durchgesungen wurde. Außerdem wurde das "…selige Lächeln" der dritten Strophe durch "mit einem mutigen Lächeln" ersetzt.
Der Kleine Trompeter in der DDR
Weineck wurde in der DDR offiziell glorifiziert, das Lied und seine Person verehrt:
- Straßen, Schulen und Plätze in der DDR wurden nach Fritz Weineck benannt.
- Das Lied Der kleinen Trompeter wurde von den Kindern der Grundschulen auswendig gelernt.
- 1958 erfolgte im Rahmen des III. Pioniertreffens in Halle (Saale) eine Umbenennung des Rive-Ufers der Saale in Weineck-Ufer. Dort wurde das "Trompeterdenkmal" errichtet, welches für Fahnenappelle der Pionierorganisation genutzt wurde. Seit 1992 trägt das Ufer wieder den Namen Rives, zudem erinnert eine 1998 dort aufgestellte Stele mit einem Bronzeportrait an den früheren Oberbürgermeister. Die Weineck-Statue befindet sich heute im Magazin des Museums für Stadtgeschichte Halle.
- 1964 entstand der DEFA-Film Das Lied vom Trompeter von Konrad Petzold.
- Vom Kinderbuchverlag Berlin wurde die Taschenbuchreihe Die kleinen Trompeterbücher herausgegeben. Die Geschichte über Weineck ist als Band 1 der Reihe erschienen.
- Erich Honecker wünschte, dass das Lied an seinem Grab gespielt werde.
Quelle: Ulrich Weissgerber, Giftige Worte der SED-Diktatur: Sprache als Instrument von Machtausübung und Ausgrenzung in der SBZ und der DDR, LIT Verlag Münster, 2010
(Ministerium für) Staatssicherheit

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (kurz MfS oder Stasi) war der Inlands- und Auslandsgeheimdienst der DDR und zugleich Ermittlungsbehörde (Untersuchungsorgan) für "politische Straftaten". Das MfS war innenpolitisch vor allem ein Unterdrückungs- und Überwachungsinstrument der SED ("Schild und Schwert der Partei") gegenüber der DDR-Bevölkerung, das dem Machterhalt diente. Dabei setzte es als Mittel Überwachung, Einschüchterung, Terror und die so genannte Zersetzung gegen Oppositionelle und Regimekritiker ("feindlich-negative Personen") ein.
Da das MfS den höchsten Sicherheitsanspruch aller Organisationen in der DDR hatte, war die Auswahl möglicher späterer hauptamtlicher Mitarbeiter von höchster Bedeutung. Neben einer körperlichen, intellektuellen, mentalen und fachlichen Voraussetzung stand die politische Zuverlässigkeit an vorderer Stelle. Dabei spielte der gesellschaftliche Werdegang die entscheidende Rolle. Man suchte die sogenannte sozialistische Persönlichkeit mit dem klaren Klassenstandpunkt, also das, worauf die gesamte politische Erziehung im DDR-Schulsystem hinarbeitete.
Das MfS wurde am 8. Februar 1950 gegründet. Der Sprachgebrauch der SED, der das MfS als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnete, beschreibt die ihm zugedachte Funktion im politisch-ideologischen System der DDR.
Am 24. Januar 1950 fasste das Politbüro der SED den Beschluss zur Bildung des MfS. Zwei Tage später empfahl die Regierung der DDR parallel zum eigenen "Beschluss über die Abwehr von Sabotage" ebenfalls die Bildung des MfS. Am 8. Februar 1950 bestätigte die Volkskammer der DDR einstimmig das Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit. Eine Kontrolle des neugeschaffenen Ministeriums durch Parlament oder Ministerrat war im Gesetz nicht vorgesehen. Bis Ende des Jahres beschäftigte das neu gegründete Ministerium bereits rund 2700 Mitarbeiter.

Am 16. Juni 1951 eröffnete Walter Ulbricht die "Schule des Ministeriums für Staatssicherheit" in Golm bei Potsdam. 1955 wurde sie in "Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit" umbenannt, obgleich sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Hochschule im eigentlichen Sinn war.
Während der gesamten 1950er-Jahre wurden in zahlreichen "Säuberungen" Parteimitglieder verhaftet, die während der Zeit des Nationalsozialismus in westliche Länder emigriert waren; auch andere SED-Mitglieder wurden Opfer dieser Aktionen.
Das MfS konnte seinen Personalbestand kontinuierlich ausbauen. Verfügte die MfS-Vorgängerorganisation 1949 nur über 1.150 feste Mitarbeiter, so stieg diese Zahl bis zum 31. Oktober 1989 auf 91.015 hauptamtliche MfS-Mitarbeiter an. Seit seiner Existenz beschäftigte das MfS rund 250.000 Personen hauptamtlich.
In Bezug auf die Einwohnerzahl bildete das MfS mit einer Quote von einem hauptamtlichen Mitarbeiter auf 180 Einwohner (Stand: 1989) den größten geheimdienstlichen Apparat der Weltgeschichte (Zum Vergleich: In der Sowjetunion kam 1990 ein KGB-Mitarbeiter auf 595 Einwohner, im Dritten Reich in den Grenzen von 1937 ein Gestapo-Mitarbeiter auf rund 8.500 Einwohner).
Da sich das MfS als "Schild und Schwert der Partei" verstand, waren seine Mitarbeiter nahezu ausnahmslos Mitglieder der SED, einzige Ausnahme waren junge, noch neue Hauptamtliche, die noch in der "Kandidatenphase" zur SED-Mitgliedschaft waren. Quellen: www.wikipedia.de; www.stasimuseum.de
Westemigrant

Als Westemigrant galt in der SBZ und der DDR ein Mitglied der früheren KPD oder SPD, das Schutz vor den Verfolgungen der Nationalsozialisten nicht in der Sowjetunion, wie Walter Ulbricht und viele andere spätere Mitglieder der SED-Führung, sondern im westlichen Ausland gesucht hatte. Im Parteijargon wurden die Westemigranten auch ‚Westler' genannt, zu denen die SED auch in westalliierte Kriegsgefangenschaft geratene führende SED-Funktionäre zählte.
Quelle: Ulrich Weissgerber, Giftige Worte der SED-Diktatur: Sprache als Instrument von Machtausübung und Ausgrenzung in der SBZ und der DDR, LIT Verlag Münster, 2010
In der DDR gab es keine der Großen Säuberung in der Sowjetunion vergleichbaren Aktionen innerhalb der SED, zumindest gab es keine massenhaften Todesurteile und keine Schauprozesse gegen absolute Spitzenfunktionäre. Trotzdem bürgerte sich der Begriff Säuberung, auch getragen von den Westmedien, im vertraulichen Sprachgebrauch ein: Damit wurden v.a. die vereinzelten Wellen von Parteiausschlüssen oder auch Verurteilungen bezeichnet, die sich zu Beginn und um die Mitte der 50er Jahre häuften.
Beispiele für Opfer solcher "Säuberungen" nach DDR-Zuschnitt waren Wilhelm Zaisser und Rudolf Herrnstadt, die wegen "Fraktionsbildung" aus ihren Ämtern entfernt wurden. Eine relativ lang anhaltende Säuberungswelle wurde durch das Misstrauen der Stalin-treuen SED-Führung gegenüber "Westemigranten" ausgelöst. Hierbei wurde solchen Altkommunisten, die während der Nazizeit nicht in die SU emigriert waren, generell ideologische Unzuverlässigkeit unterstellt; viele verloren ihre Funktionen, einige wurden verurteilt und hingerichtet. Makabererweise wurde diese Säuberung ausgerechnet vom Westemigranten Erich Mielke maßgeblich geführt. Er überstand sie denn auch ohne Schaden.
Quelle: www.ddr-wissen.de
Abschnittsbevollmächtigter
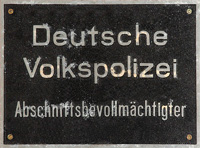
Ein Abschnittsbevollmächtigter (ABV) war in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ein Polizist der Volkspolizei (VP), der für die polizeilichen Aufgaben in einzelnen Straßen oder Wohngebieten zuständig war.
In seinem Abschnitt war er polizeilicher Ansprechpartner für die Bewohner und versah Streifendienst. Er war für die Aufnahme und Weiterleitung von Strafanzeigen und polizeiliche Prävention zuständig. Der ABV hatte ähnliche Aufgaben wie ein heutiger Kontaktbereichsbeamter der Polizei.

Darüber hinaus war der ABV in seinem Abschnitt zuständig für Verkehrskontrollen, Kontrollen der Einhaltung der Meldepflicht (Hausbücher) und auswärtiger Besucher sowie die Kontrolle von Personen, über die staatliche Auflagen verhängt waren.
Er gab Einschätzungen über Bewohner seines Abschnitts ab, wenn beispielsweise über die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach einer Sperre oder über die Genehmigung einer Reise in das Nichtsozialistische 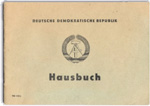
Wirtschaftsgebiet entschieden werden sollte. Für die Genehmigung solcher Reisen wurden die Einschätzungen des ABV durch die zuständigen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit eingesehen und sie dienten als Grundlage für eine Genehmigung oder Versagung.
Die ABV wurden ab Oktober 1952 nach sowjetischem Vorbild eingeführt. Der ABV wurde von freiwilligen zivilen Helfern der VP unterstützt.Quelle: www.wikipedia.de
OMS

Bei der OMS handelt es sich um eine Komintern-eigene Organisation zur Auslandsaufklärung, genannt Abteilung Internationale Verbindungen (russisch: Otdel Meschdunarodnych swjasei, OMS), die "technische" Aufgaben (Geldtransfers, Korrespondenzen, Dokumentenherstellung etc.) der Komintern in Deutschland und weiten Teilen Europas organisierte.
Quelle: wikipedia